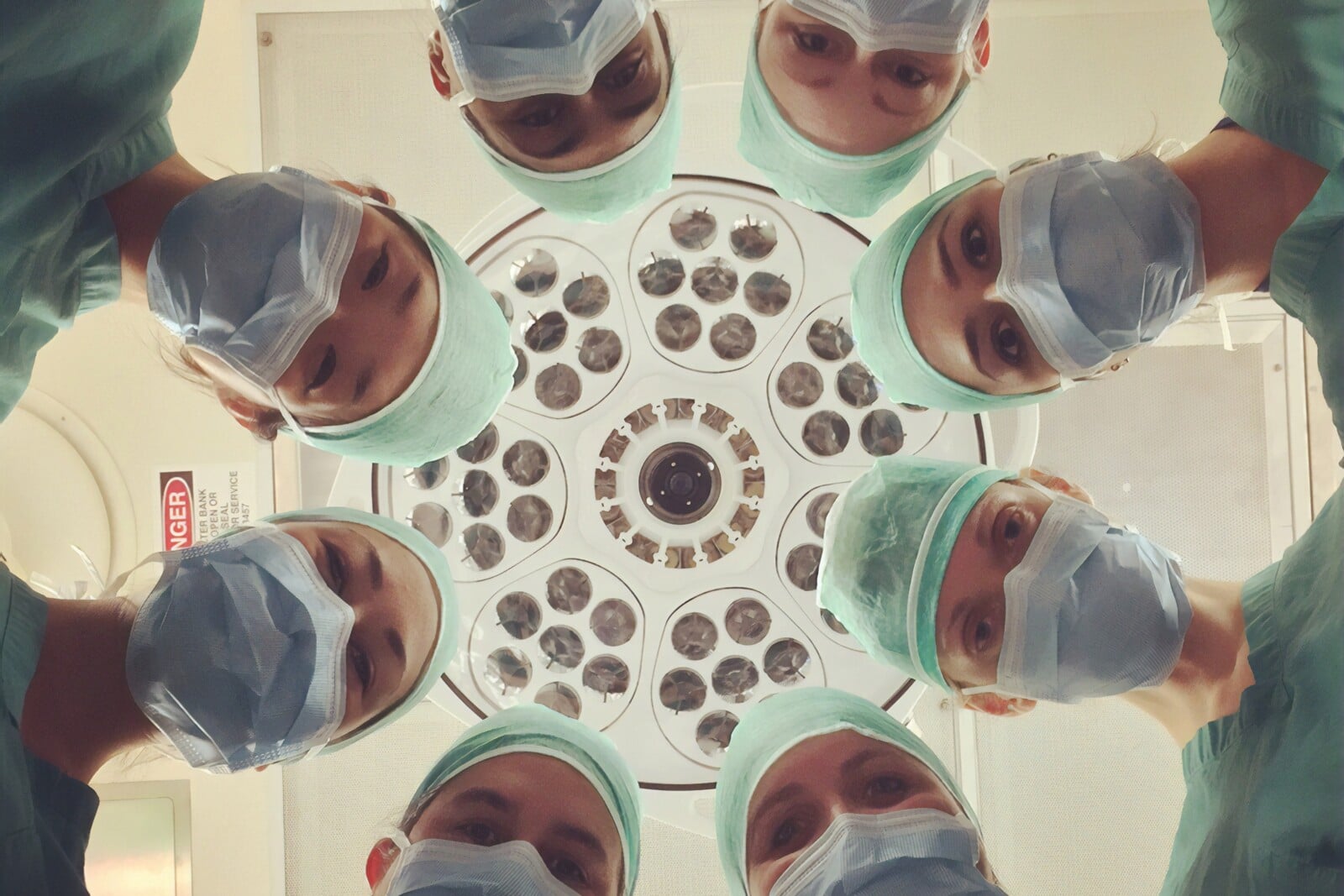Die Corona-Pandemie hat manche Schwächen des deutschen Gesundheitssystems aufgedeckt, nicht zuletzt die Rückstände bei der Digitalisierung. Grundlegende Fragen, wie die Dualität des Systems oder die Steuerung durch finanzielle Anreize und Wettbewerb, traten in der Pandemie eher in den Hintergrund – spielen aber eine große Rolle für die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens. Eben diese Fragen haben wir in den letzten Monaten in unserer Makronom-Serie zur Zukunft des Gesundheitswesens in insgesamt acht Beiträgen erörtert. Deren Kernaussagen fasst dieser Beitrag zusammen.
Die Dualität des deutschen Krankenversicherungssystems ist ein Problem
Die Dualität mit gesetzlicher und privater Krankenversicherung (GKV und PKV) ist in Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Industrieländern einmalig. Unterschiedliche Erstattungssätze bei gleichem Leistungsangebot und ohne unterschiedliche Versorgungsnetzwerke gibt es in keinem anderen Land. Dies hat ein Autorenteam um Nicolas Ziebarth von der Cornell-Universität in den USA in ihrem Beitrag „Wie stark das deutsche Gesundheitssystem Privatpatienten bevorzugt“ zum Anlass genommen, Zugangsbarrieren zur Gesundheitsversorgung zu untersuchen. Ein wesentlicher Indikator ist dabei die Wartezeit, die deutsche Patienten bei der Terminvergabe in Kauf nehmen müssen. Da Ärzte für Privatpatienten einen im Durchschnitt doppelt so hohen Erstattungssatz erhalten, ist zu vermuten, dass Privatpatienten bevorzugt werden.
Die Autoren berichten über eine randomisierte Feldstudie, in der sie Testpersonen um einen Termin bitten ließen. Tatsächlich gelang dies Privatpatienten mit statistisch signifikant höherer Wahrscheinlichkeit und sie mussten nur halb so lang wie gesetzlich Versicherte auf diesen Termin warten. Das Experiment lieferte zudem Hinweise darauf, dass die Diskriminierung zunimmt, wenn die Unterschiede in den Erstattungssätzen für die jeweilige Leistung größer sind. Würden diese Unterschiede zwischen privat und gesetzlich Versicherten eingeebnet, könnten Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung – die ein Großteil der Deutschen als ungerecht empfinden – beseitigt werden.
Auch Stefan Greß bezieht sich auf die höhere Vergütung für die Behandlung von Privatpatienten und die kürzeren Wartezeiten bei der Terminvergabe – und fordert die Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Dass Versicherte in den privaten Krankenkassen in der Regel einkommensstärker und gesünder als gesetzlich Versicherte sind, schwächt den Risikopool und die Beitragsbasis der GKV. Das Anreizsystem führt zudem zu einer Unterversorgung gesetzlich Versicherter und einer Überversorgung von Privatpatienten. Zudem gibt es Fehlanreize bei der Niederlassungsentscheidung.
Greß sieht zwei Optionen für alternative Finanzierungssysteme: Zum einen könnte die Einführung einer Kopfpauschale für die Beiträge bei gleichzeitigem staatlichen Transfer für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen die Attraktivität privater Versicherungen mindern, weil die GKV dann deutlich geringere Prämien erheben würde. Problematisch an diesem Modell ist allerdings der dafür erforderliche hohe öffentliche Finanzierungsbedarf. Zum anderen spricht er sich für eine Bürgerversicherung für alle aus. Private Krankenversicherungen könnten in einem solchen System nur noch Zusatzversicherungen anbieten. Problematisch ist hier die Übergangsphase, denn Versicherte mit bestehenden Leistungsansprüchen können vermutlich nicht zur Versicherung in einer GKV verpflichtet werden. Bisher hat es keinen politischen Konsens für eine Bürgerversicherung gegeben, die auch keinen Eingang in das Koalitionspapier gefunden hat.
Wie sollte der Krankenhaussektor gesteuert werden?
Mirella Cacace und Tanja Klenk werfen in ihrem Beitrag einen Blick auf die Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems im Ländervergleich. Vor allem die gute Ausstattung des deutschen Gesundheitsbereichs in Hinblick auf die Krankenhausbetten fiel in der Corona-Pandemie auf. Eine Bertelsmann-Studie vergleicht die Krankenhauslandschaft in Dänemark, Schweden, Spanien und Israel mit dem deutschen System. In den erstgenannten drei Ländern ist das System staatlich gelenkt, Israel hat wie Deutschland eine soziale Krankenversicherung etabliert. Die Gesundheitsversorgung in Dänemark und Schweden ist zentral organisiert und verfügt über vernetzte Strukturen, die ambulante und stationäre Leistungen anbieten. Das spanische System ist dezentral strukturiert.
Untersucht wurden Flexibilität sowie Fähigkeiten zur Anpassung, zusätzliche Kapazitäten und Ressourcen bereitzustellen und übermäßige Leerkapazitäten zu vermeiden. In Spanien und Deutschland wurden in der Pandemie Probleme bei der Abstimmung zwischen den politischen Ebenen diagnostiziert. Die Anpassungsleistungen an die erhöhten Anforderungen wurden für Schweden, Dänemark und Israel als am besten beurteilt. Probleme gab es in allen Ländern in Hinblick auf die aktuelle Verfügbarkeit von Daten. Am besten schnitten die Länder mit einer zentralisierten Steuerung der Pandemiesituation ab.
Zu einem etwas anderen Ergebnis kommt Marc Bataille vom wissenschaftlichen Stab der Monopolkommission in seinem Beitrag „Wo wir Planung brauchen und wo Wettbewerb“. Die im OECD-Vergleich einmalig hohe Zahl von Krankenhausbetten pro Einwohner sollte vor der Pandemie gesenkt werden. Dieses hält Bataille nach wie vor für sinnvoll. Angestrebt werden sollte eine Veränderung der Marktstruktur mit dem Ziel, flächendeckend Leistungen zu erbringen und eine hohe Versorgungsqualität zu schaffen. Im Zentrum steht hier eine Verbesserung der Organisation des Krankenhaussektors, die auch bei einer geringeren Zahl von Krankenhausbetten zu einer besseren Versorgungsqualität führen kann.
Bataille stellt die Frage: „Kann man aber womöglich im Gesundheitsbereich auf so eine dezentrale Entscheidung durch die Krankenhäuser zugunsten gesundheitspolitischer Planung verzichten?“ Seine Antwort lautet: Nein. Zwar gibt es im deutschen System einen Konflikt zwischen Planung und Wettbewerb. Dennoch sollten der Wettbewerb und damit die dezentrale Planung weiterhin ein wichtiges Steuerungsinstrument bleiben. Daher ist „eine Vorfestlegung zu vermeiden, nach der die Krankenhauslandschaft vor allem durch staatliche Planung, vom Bund oder den Ländern, durch Markt und Wettbewerb oder durch Regulierung organisiert werden sollte“.
Simon Reif vom ZEW sucht in seinem Beitrag „Wege zu einem klugen Gesundheitssystem“. Er beschäftigt sich mit der dualen Finanzierung des Krankenhaussektors, wobei die Länder für die Investitionen zuständig sind und die Krankenkassen für die laufenden Kosten, die von den Krankenhäusern über Fallpauschalen abgerechnet werden. In der Pandemie entstand ein Problem, weil diese an tatsächlichen Behandlungen orientierte Finanzierung nicht berücksichtigt, dass Krankenhäuser Leistungen vorhalten müssen. Für solche Fälle könnten allerdings Vorhalteprämien genutzt werden.
Die Vergütung im Krankenhausbereich hat sich auch als Hindernis für eine mögliche „Ambulantisierung“ der Krankenhausbehandlung erwiesen. Die stationäre und die ambulante Versorgung werden nach unterschiedlichen Systemen vergütet, was zu Problemen an der Schnittstelle zwischen beiden Bereichen führt und die Effizienzpotentiale bei den Behandlungen nicht ausschöpft. Effizient ist eine Behandlung, wenn sie medizinisch das für den Patienten beste Ergebnis zu den geringsten Kosten ermöglicht. Als zukunftsfähige Lösung bietet sich ein ergebnisorientiertes Vergütungssystem an, das allerdings daran krankt, dass Behandlungserfolge nicht exakt messbar sind. Um hier voranzukommen, ist es erforderlich mehr Daten zu sammeln und zu analysieren. Erste Ansätze gibt es, ein Forschungsdatenzentrum Gesundheit befindet sich im Aufbau.
Zentrale oder dezentrale Steuerung?
Ländervergleiche, die sich auf unterschiedliche Strukturen beziehen, sind immer schwierig. Dennoch sieht Cornelia Heintze (trotz unterschiedlicher politischer Kulturen und makroökonomischer Kontexte) in ihrem Beitrag Gemeinsamkeiten einerseits innerhalb jener Staatengruppe, die ihren Gesundheitssektor sowohl primär öffentlich finanziert, als auch die Leistungen in öffentlichen Einrichtungen erbringt, und andererseits der Staatengruppe mit fragmentierten Strukturen. Als Beispiel wird die Booster-Impfquote in der Corona-Pandemie genannt: Hier erreichen die meisten Länder mit staatlichem Gesundheitssystem eine höhere Impfquote bei besonders vulnerablen Altersgruppen als Länder mit korporatistischer Steuerung. Zu letzteren gehört auch Deutschland.
Deutschland wird von gesundheitspolitischen Akteuren oftmals als weltweit bestes System beschrieben. Zwar gehören die Ausgaben für den Gesundheitssektor gemessen am BIP mit den USA und der Schweiz zu den weltweit höchsten. Wenn allerdings die großen ländervergleichenden Indizes mit unterschiedlichsten Indikatoren konsultiert werden, sieht die Bewertung nicht mehr so gut aus: Beim Euro Health Consumer Index – einem Vergleich von 35 Ländern – kam Deutschland 2019 auf Rang 12. Eine im Lancet publizierte Studie für 2016 sieht Deutschland im Vergleich zu 195 Ländern auf Platz 18 und in einer Untersuchung von elf Hocheinkommensländern erreicht Deutschland nur den 5. Rang.
Auch bei der Ausstattung mit Krankenhausbetten schneidet Deutschland nicht gut ab: Wie Heintze konstatiert, „kombiniert Deutschland die höchste Bettendichte mit der schlechtesten Personalausstattung“. Und in der Digitalisierung des Gesundheitswesens erreicht Deutschland in einer 17-Länder-Studie der Bertelsmann-Stiftung nur Platz 16.
Gesundheitssektor: eine digitalisierte Zukunft
Dass die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens sehr rückständig ist, hat uns die Corona-Pandemie vielfach vor Augen geführt. Thomas Lux setzt sich mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung auseinander. Die Gesundheitspolitik hat viele Anstöße für eine digitalisierte Zukunft gegeben: Schon 2016 legte der damalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe mit dem E-Health-Gesetz den Grundstein. Dem folgten noch viele weitere Gesetze. Auf dem stark regulierten sogenannten ersten Gesundheitsmarkt ist es aber nicht gelungen, „eine für alle akzeptable Lösung des Informationsaustausches und der Kommunikation zum Wohl des Patienten sowie zur Steigerung der Effizienz des Systems zu entwickeln“, so Lux.
Ein entscheidendes Hindernis für die Nutzung digitaler Infrastruktur sind die rigiden Bestimmungen des Datenschutzes. Diese werden im deutschen Gesundheitswesen kompliziert und wenig pragmatisch angewendet, wie Thomas Lux meint, während in anderen Ländern durchaus geeignete technisch-organisatorische Lösungen existieren, die den Datenschutzanforderungen entsprechen.
Dabei gibt es vielfältige Chancen durch eine ausgebaute Telematik-Infrastruktur. Zu nennen sind nur der Austausch medizinischer Informationen und telemedizinische Anwendungen. Auf dem zweiten Gesundheitsmarkt werden bereits mit der Zustimmung der User große Datenmengen generiert, so beispielsweise durch Wearables. Große Tech-Unternehmen wie Amazon, Google, Microsoft oder Apple bieten bereits telemedizinische Leistungen an, wie z.B. Videosprechstunden, oder organisieren den kompletten Service- und Versorgungsprozess.
Fazit: Das deutsche Gesundheitswesen ist schlechter als sein Ruf
Alles in allem stellen die Autorinnen und Autoren dem deutschen Gesundheitssektor kein gutes Zeugnis aus – das in jedem Fall deutlich schlechter ausfällt als sein Ruf: Die Dualität des deutschen Systems führt zu einer ungleichen Behandlung der Versicherten, die auch als ungerecht empfunden wird. Der Krankenhaussektor verfügt zwar über mehr Betten als andere Länder, hat aber weniger Personal und ist weniger flexibel. Zwar hält die Monopolkommission eine dezentrale Marktstruktur für effizienter, die vorgestellten Vergleichsstudien haben aber ergeben, dass vor allem zentral organisierte Gesundheitssysteme besser abschneiden. In Hinblick auf die Digitalisierung hat Deutschland trotz diverser gesetzlicher Anstöße noch sehr viel nachzuholen.
Zur Autorin:
Susanne Erbe ist Redakteurin beim Makronom. Bis Ende 2020 war sie stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Wirtschaftsdienst. Auf Twitter: @susanneerbe