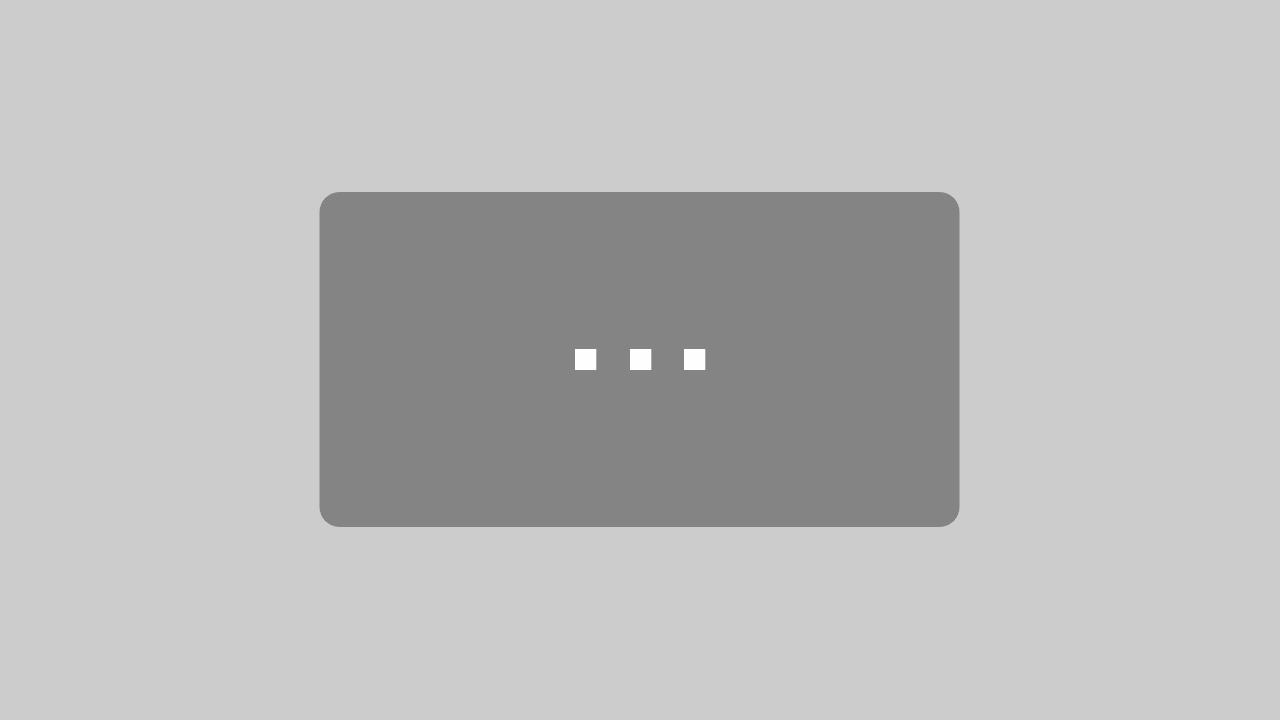In den „Fremden Federn“ stellen wir einmal pro Woche in Kooperation mit dem Kuratorendienst piqd eine Auswahl von lesenswerten journalistischen Fundstücken mit wirtschaftspolitischem Bezug zusammen. piqd versteht sich als eine „Programmzeitung für guten Journalismus“ – was relevant ist, bestimmen keine reichweitenoptimierten Algorithmen, sondern ausschließlich ausgewählte Fachjournalisten, Wissenschaftler und andere Experten.
Die Zukunft der Arbeit(erpartei)
 piqer:
piqer:
Ali Aslan Gümüsay
Arbeit hat sich gewandelt, die Arbeiterpartei SPD stagniert dagegen in ihrem Bild vom Menschen in seiner Lohnabhängigkeit – einem „zweidimensionalen Arbeitsbegriff“. Sie steht nicht für, sondern gegen etwas: gegen Befristungen, gegen Leiharbeit, gegen hohe Managerboni, gegen Lohndumping.
Felix Dachsel fordert ein Umdenken, überspitzt als Auflösen und Neugründen der Partei formuliert. Der Kampf um die Arbeit ist kein Wettstreit zwischen Mensch und Maschine, sondern mit Maschine gegen prekäre Arbeit. Vielleicht ist die SPD++ ein Ansatz.
Der Autor ist Mitglied der SPD, weil sie progressiv, links, pragmatisch mit Herz war. Nun wünscht er sich eine radikal positive, radikal zukünftige Partei – die Arbeit und sich neu denkt und bewegt.
Wärst du ein guter Uber-Fahrer?
 piqer:
piqer:
Karsten Lemm
Die Leute, die dein Privattaxi gerufen haben, wollen mit einer Ladung Hamburger und Pommes ins Auto klettern. Willst du sie trotzdem mitnehmen? Den Mund halten, wenn sie anfangen zu essen, auf die Gefahr hin, dass sie Ketchup verkleckern? Oder lieber „nein“ sagen – und damit eine schlechte Bewertung in der Uber-App riskieren? Auch wenn das womöglich bedeutet, dass künftige Gäste lieber einen anderen Fahrer wählen.
Dutzende solcher Entscheidungen muss man fällen, wenn man sich auf diesen interaktiven Test der Financial Times einlässt. Das Ganze ist aufgezogen wie ein Spiel, samt Grafiken und unterschiedlichen Ergebnissen, je nach selbst gewähltem Handlungsstrang – aber die Situationen, vor denen Nutzer stehen, spiegeln die Realität in der Gig Economy wieder, denn der Test beruht auf Gesprächen, die FT-Reporter mit diversen Uber-Fahrern geführt haben.
Was sich sehr schnell zeigt: Selbst wer bereit ist, vieles zu schlucken, um Fahrgäste oder Uber nicht zu verärgern, kommt am Ende finanziell nicht unbedingt weit. Reparaturen gehen auf eigene Kosten, genauso wie Leasing-Gebühren, Tanken und das Reinigen des Autos, das nur im Dauerbetrieb Geld verdient – also genauso geschunden wird wie der Körper des Fahrers, der wenig Ruhe bekommt, wenn am Ende des Monats das Geld reichen soll für die Miete.
Ich zumindest habe es nicht geschafft, genug zum Leben zu verdienen, selbst im leichten Spielmodus. Aber vielleicht geht’s euch besser? So oder so: Der FT ist es gelungen, ein Musterbeispiel für die spielerische Vermittlung von Wissen zu schaffen.
Verliererthema Armut?
 piqer:
piqer:
Christian Huberts
Am 4. und 5. Oktober 2017 veranstaltete die Nationale Armutskonferenz unter dem etwas holprigen Motto »Flagge zeigen – Soziale Rechte, Beteiligung, Menschenrecht« ein Treffen für Menschen mit Armutserfahrung in Berlin. Warum so eine Veranstaltung überhaupt notwendig und sinnvoll ist, erklärt im SWR2-Kulturgespräch der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Neben den üblichen, wichtigen Differenzierungen (von Armut bedroht sein in Abgrenzung zu absoluter Armut) und Klarstellungen (Mangel an sozialer Mobilität wiegt schwerer als das bloße Fehlen von Geld), kommen dabei vor allem zwei eher selten behandelte Aspekte zur Sprache:
Die politische Vertretung von relativ armen Menschen in Deutschland lohnt sich nicht, weil in den entsprechenden Milieus die Wahlbeteiligung schlicht zu niedrig ist. Armut sei ein »Verliererthema«, wie Sell es formuliert. Außerdem herrsche in der öffentlichen Wahrnehmung die Trennung von »würdigen« und »unwürdigen« Armen, also jenen, die ohne eigene Schuld in Armut geraten sind und jene, die es vermeintlich nicht besser verdient haben. Eine Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die sich zum Beispiel im Kontext der Abwertung von Langzeitarbeitslosen bei rund der Hälfte der Bevölkerung aufzeigen lässt. Exemplarisch lässt sich die Konsequenz dieser beiden Phänomene wohl am vergangenen Bundestagswahlkampf der SPD illustrieren: Unter dem Schlagwort »soziale Gerechtigkeit« wurden dort Maßnahmen angekündigt, die sich in erster Linie an »würdige« ALG1-Empfangende, nicht aber an »unwürdige« und politikverdrossene Hartz-IV-Beziehende richteten.
Das jährliche Treffen der Menschen mit Armutserfahrung in Berlin wird an diesen zentralen Problemen auf die Schnelle nicht viel ändern können. Aber es ist ein wichtiger Versuch, Menschen, die von Armut bedroht sind, ein Forum zu geben, öffentliche Sichtbarkeit herzustellen und politisch zu mobilisieren.
Alles kam anders
 piqer:
piqer:
Eric Bonse
Als der Maastricht-Vertrag 1992 geschlossen und damit die Grundlage für den Euro gelegt wurde, galt die größte deutsche Sorge dem Kampf gegen die Inflation. Die so genannten Maastricht-Kriterien sollten verhindern, dass der Euro zur “Weichwährung” werden könnte. Das ist auch gelungen. Und doch kam dann fast alles anders, als man sich das in Maastricht dachte.
So ist heute nicht zu viel Inflation, sondern zu wenig das Problem, mit dem die Europäische Zentralbank kämpft – mit unkonventionellen Mitteln, die gerade in Deutschland auf Skepsis und Widerstand treffen. Paradoxerweise wird die Bank dazu durch das Inflationsziel von zwei Prozent verpflichtet – andere Ziele der Geldpolitik, etwa Wirtschaftswachstum, hatte Berlin verhindert.
Nicht vorhergesehen wurde auch, dass die Währungsunion zu mehr Divergenzen in der Eurozone führen würde – und nicht zu mehr Konvergenz, wie geplant. Und niemand hat wohl damit gerechnet, dass die Drei-Prozent-Regel für die Neuverschuldung auch von Deutschland mißachtet würde – genau wie die No-Bailout-Klausel, die während der Eurokrise verletzt wurde.
Wie konnte es dazu kommen? Und wie geht es nun weiter? Diesen Fragen geht FAZ-Autor G. Braunberger in diesem Blogeintrag nach. Angesichts der deutsch-französischen Debatte um eine Reform der Währungsunion ist dies ein wichtiger, wenn auch nicht immer überzeugender Beitrag.
Der neue Wirtschaftsnobelpreisträger und Selena Gomez erklären die Finanzkrise
 piqer:
piqer:
Rico Grimm
Richard H. Thaler hat den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften gewonnen. Thaler legte in seinen Arbeiten die Grundlage für die Verhaltensökonomie, die zeigt, dass wir Menschen viel subjektiver, irrationaler und sozial bedingter handeln als die klassischen Wirtschaftstheorien annehmen. Wenn man das aber ernst nimmt, verändert sich komplett wie wir auf die Wirtschaft blicken und wie wir sie beschreiben können.
Das in meinen Augen wirklich Besondere an Thaler und den anderen Verhaltensökonomen: Sie haben es geschafft, das manchmal sehr abstrakt wirkende Feld der Wirtschaftswissenschaft mit dem Alltag zu vermählen, den wir jeden Tag selbst erleben. Daraus resultierte dann auch Thalers bekannteste Arbeit zum Nudging (hier eine Besprechung des entsprechenden Buches, hier eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Arbeiten): Wenn wir wissen, dass wir Menschen sehr fehlbar sind, können wir dieses Wissen nutzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, wir können uns selbst gewissermaßen austricksen, indem wir Systeme so gestalten, dass sie “gutes” Verhalten belohnen. Patrick Bernau hat in der FAZ mal drei Beispiele für dieses Nudging herausgesucht.
Mit den Links oben bekommt ihr einen guten Eindruck von Thalers Arbeit – aber der definitiv unterhaltsamere ist dieses Video: ein Ausschnitt aus dem Hollywood-Streifen The Big Short, in dem Thaler zusammen mit der Schauspielerin Selena Gomez erklärt, was synthetische Derivate sind und wie sich diese Finanzinstrumente die menschliche Psyche zunutze machen.
Internationale Energieagentur: Das solare Zeitalter ist da
 piqer:
piqer:
Daniela Becker
Im vergangenen Jahr ist die Photovoltaik weltweit stärker gewachsen als alle anderen Energiearten. 2016 wurden Solaranlagen und -kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 74.000 Megawatt zugebaut. Damit liegt das solare Wachstum erstmals über dem Netto-Zubau von Kohlekraftwerken, der 57.000 Megawatt betrug. Das geht aus einem Bericht der Internationalen Energieagentur IEA hervor. Am stärksten war der Zubau in China.
Die Organisation erwartet auch für die kommenden Jahre ein weiteres starkes Wachstum. Bis 2022 könnten die Erneuerbaren-Kapazitäten um 43 Prozent steigen. „Wir erwarten, dass die Erneuerbaren um etwa 1000 Gigawatt bis 2022 wachsen, was etwa die Hälfte der derzeit installierten globalen Kapazitäten für die Kohleverstromung entspricht, die in 80 Jahren aufgebaut wurden“, so Fatih Birol, Direktor der IEA. „Wir sind Zeuge der Geburt einer neuen Ära für die Photovoltaik. Wir erwarten, dass die Photovoltaik-Kapazitäten schneller als die aller anderen Erneuerbaren-Technologien bis 2022 wachsen werden“, so Birol weiter.
Die ausführliche Meldung auf Englisch gibt es auf den Seiten der IEA.
Zudem sind die Stromgestehungskosten bei den Erneuerbaren kontinuierlich weiter drastisch gefallen.
Die Kosten seien bis auf 3,0 Cent pro Kilowattstunde gesunken. Damit seien die Stromgestehungskosten für Photovoltaik und Windkraft bereits teilweise niedriger als aus neu gebauten Gas- und Kohlekraftwerken, heißt es bei der IEA weiter.
Mit dieser Prognose ist die IEA endlich aus einem jahrelang währenden Dornröschenschlaf erwacht. Denn bisher hatte die Organisation Jahr für Jahr das Wachstumspotenzial der Erneuerbaren auf groteske Art und Weise unterschätzt. Viele Volkswirte orientieren sich an den Aussagen der IEA. Deswegen ist es so wichtig, dass diese eher konservative Organisation der OECD anerkennt: Das solare Zeitalter ist da.
Wie besteuert man Google und Co.?
 piqer:
piqer:
Christian Odendahl
Steuern sind so ein Thema, das gleichzeitig wichtig und zu komplex für einfache Texte ist. Doch nun bin ich auf einen Text gestoßen, der zwar lang ist, aber das Thema “Besteuerung von Google und Co.” mal richtig durchdekliniert. Der Text hätte hier und da einfacher formuliert sein können, das ist vielleicht das Schicksal von Texten deutscher Akademiker. Aber er ist verständlich und legt den Finger überall in die Wunden der Politik.
Die digitale Ökonomie fügt sich nicht leicht in die etablierten Prinzipien des Steuerrechts ein. Es gibt keine klassische Betriebsstätte, so dass man nicht genau weiß, wo genau eigentlich die Wertschöpfung stattfindet. Und selbst wenn man das feststellen könnte, ist die Frage, wie z.B. eine deutsche Betriebsstätte von Google deren US Hauptquartier für die Nutzung der Suchalgorithmen entlohnen sollte. Das war bei Industrieunternehmen einfacher.
Ist der von Frankreich lancierte Ansatz der “Ausgleichssteuer” sinnvoll? Hier sind die Autoren, in meinen Augen zu Recht, skeptisch.
Auf Grundlage des Umsatzes soll also eine Art Soll-Gewinn errechnet werden, den ein Unternehmen mit einem solchen Umsatz üblicherweise hat. Auf diesen fiktiven Gewinn zahlt das Unternehmen dann den normalen Unternehmensteuersatz.
Doch wie man einen digitalen Dienst abgrenzt, und wie ein Unternehmen wie Twitter behandelt werden soll, das zwar Umsatz, aber keinen Gewinn macht, ist fraglich.
Die Autoren konzentrieren sich daher auf die Reform dessen, was als Betriebsstätte gilt (‘virtuelle Betriebsstätte’). Das ist sehr kompliziert, denn wo fängt ein einfacher Import an (der nicht besteuert wird), und wo hört Wertschöpfung in Deutschland auf? Kern einer Reform könnten Daten sein: die Gewinnung dieses Rohstoffs und deren Nutzung ist eben doch ortsgebunden, und könnte Wertschöpfung begründen.
Zum Ende gehen sie noch der Frage nach, ob man das ganze Steuersystem gleich auf den Ort des Konsums umstellen sollte. Das wäre eine Revolution, Zukunftsmusik. Oder: Neuland.
Der Teufel steckt im Detail – in jedem Fall beim Brexit
 piqer:
piqer:
Jürgen Klute
Egal wie man zur industrialisierten exportorientierten Milchindustrie Irlands steht. An ihr lassen sich in jedem Fall exemplarisch die Folgen des Brexits aufzeigen. Und ebenso exemplarisch zeigt dieses Beispiel, wie kopflos der Brexit abläuft.
Letzteres ist nicht neu. Die Konkretion, mit der Tony Connelly in seinem Artikel “Verschüttete Milch” in “The Irish Times” konkrete Folgen des Brexits aufzeigt, lässt Leserinnen und Leser dennoch fragend zurück. Das umso mehr, wenn man sich dazu noch den Umgang der britischen Regierung mit dem Brexit anschaut.
Tony Connelly zeichnet in seinem Artikel am Beispiel der milchverarbeitenden Industrie die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Nordirland und der Republik Irland sehr anschaulich nach. Ihr heutiges Geschäftsmodell basiert auf den offenen Grenzen zwischen beiden Teilen Irlands innerhalb des EU-Binnenmarktes.
Der anstehende Austritt Großbritanniens aus der EU betrifft nicht nur die Grenze zwischen den beiden Teilen Irlands, die dann zur Außengrenze der EU wird. Ohne Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU unterliegen die Milchprodukte, die zukünftig aus Nordirland in die Republik Irland kommen und umgekehrt den WTO-Zollregeln. Tony Connelly fragt in seinem Artikel nach den absehbaren Folgen dieser Entwicklung für die beteiligten Akteure beiderseits der Grenze.
Die Folgen des Brexits sind aber noch viel weitergehend. So fragt Tony Connelly auch nach den Konsequenzen des Brexits für den zukünftigen Export von Milchprodukten aus der Republik Irland in Nicht-EU-Länder. Selbst wenn es ein Handelsabkommen zwischen GB und der EU gibt: Milch aus Nordirland ist nach dem Brexit kein EU-Produkt mehr. Es gibt aber EU-Handelsabkommen, die für bestimmte Produkte vorschreiben, dass sie ausschließlich aus der EU kommen dürfen. Viele der Produktionskapazitäten wurden erst in jüngerer Zeit aufgebaut.
Eigentlich sollte man erwarten, dass auch Brexiter angesichts dessen, was Tony Connelly darlegt, fragend und nachdenklich werden.
Was ist nur aus Cool Britannia geworden?
 piqer:
piqer:
Eric Bonse
Erinnert sich noch jemand an “Cool Britannia”? Das war so in den 80er, 90er Jahren. Doch spätestens seit dem Brexit ist davon keine Rede mehr. Die Briten gelten nicht mehr als cool, sondern als ziemlich nervig – wenigstens jene, die für den Austritt gestimmt haben. Und die anderen werden bemitleidet.
Wie konnte es so weit kommen? Und was hat das mit Deutschland und der Bundestagswahl zu tun? Diesen Fragen geht M. Leonard vom European Council on Foreign Relations nach. Dabei kommt er zu einem bemerkenswerten Schluss:
How, then, did the country move from cosmopolitanism back to nationalism and nativism? The short answer is that Britain’s rebranding became a victim of its own success. By accommodating previously excluded citizens, the new national story made those at the center of the older, narrower version feel like a threatened minority. And when the Brexit referendum rolled around, they fought back.
Ähnliches könnte auch in Deutschland passieren, warnt der britische Experte. Lesenswert!
Was von der Finanzkrise in Deutschland bleibt: ungelesene Akten
 piqer:
piqer:
Rico Grimm
Der wahrscheinlich letzte große Prozess, der in Deutschland wegen der Finanzkrise geführt wurde, wurde eingestellt – gegen die Zahlung von 18.000 bzw. 25.000 Euro. Zwei ehemalige Vorstände der damaligen Immobilienbank Hypo Real Estate standen in München vor Gericht; ihnen wurde vorgeworfen, die geschäftliche Situation der Bank vor der Finanzkrise beschönigt zu haben. Ob sie das wirklich getan haben? Man weiß es nicht. Und darin liegt wahrscheinlich der eigentliche Skandal. Denn der Prozess, der symbolisch genauso wichtig ist wie der Zschäpe-Prozess oder der BDN/NSA-Untersuchungsauschuss im Bundestag, wurde eingestellt bevor das zentrale Gutachten fertig war. Im Keller des Landgerichts München liegen noch immer 99 Aktenboxen, die niemand gelesen hat – und wahrscheinlich niemand je lesen wird. Dabei hat die Finanzkrise Deutschlands Bürger Dutzende Milliarden gekostet und wie kein zweites Ereignis die ganze Fragilität unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystem offenbart.