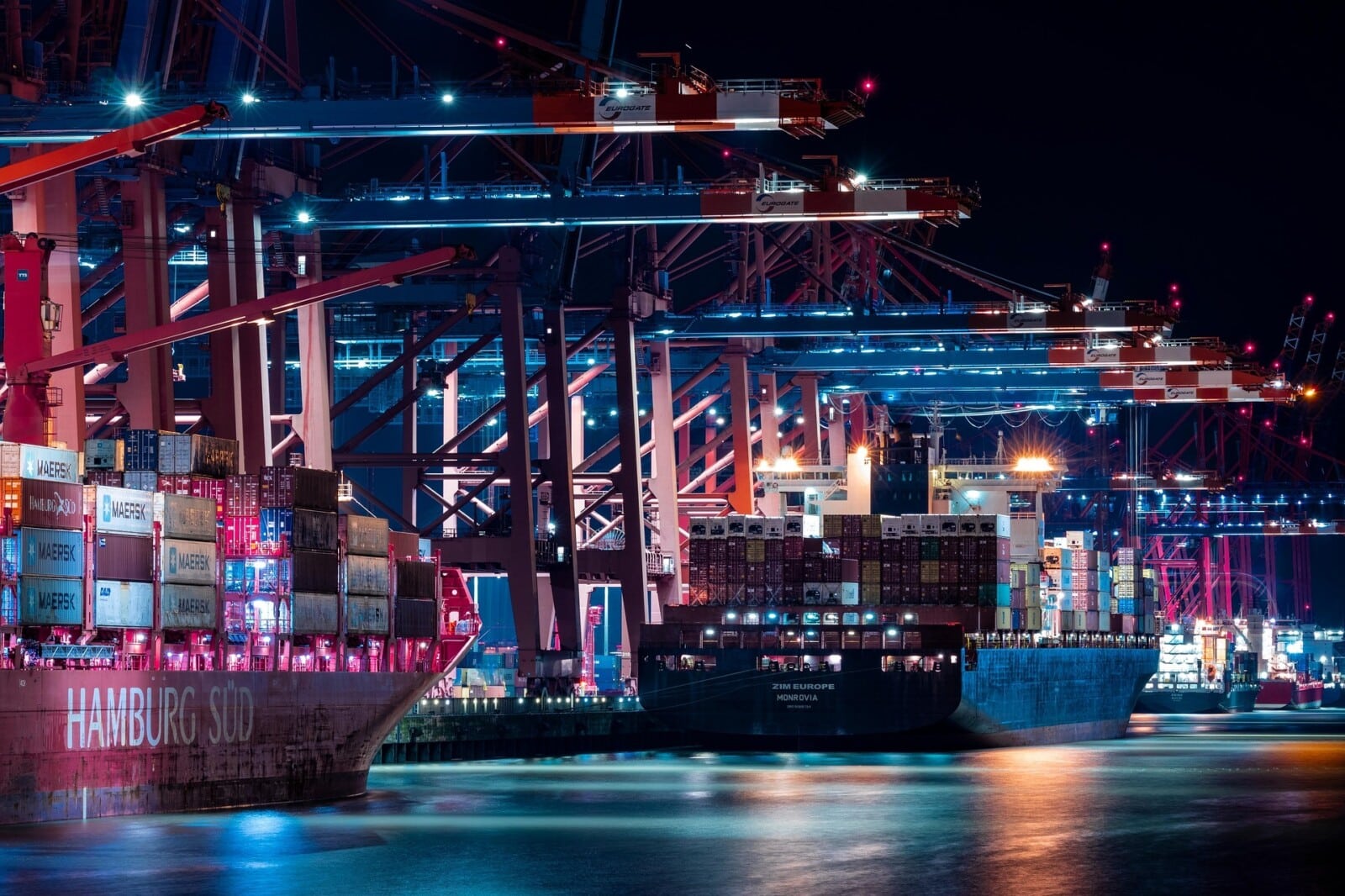Am vergangenen Sonntag haben sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump auf ein vorläufiges Handelsabkommen geeinigt. Für den Mittelstand ist besonders relevant, dass die US-Importzölle bei den meisten Waren nur auf 15% statt der zuvor im Raum gestandenen 30% steigen. In anderen Bereichen, wie in der Pharmaindustrie, bleibt die Entwicklung der Zollhöhe noch unklar, für Stahl- und Aluminiumimporte in die USA werden weiterhin 50% erhoben.
Zwar wurde durch das vorläufige Abkommen die seit Anfang April herrschende Unsicherheit zumindest etwas verringert, die die Auslandsaktivitäten der mittelständischen Unternehmen belastet hatte. Auch wurde ein eskalierender Handelskrieg vermieden, der die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung für die Unternehmen zunichtegemacht und letztlich allen beteiligten Akteuren – Wirtschaft, Verbraucher und den Staaten – geschadet hätte. Gleichwohl kann das erratische Vorgehen des US-Präsidenten jederzeit wieder dazu führen, dass die Zollhöhe und die Handelsbeziehungen zwischen USA und EU in Frage gestellt und neu ausverhandelt werden müssen. Der Bruch der US-Handelsbeziehungen mit Mexiko und Kanada durch die US-Administration in den vergangenen Monaten belegt dies sehr anschaulich.
Mittelstand und Politik angesichts der (in-)direkte Wirkungen der US-Zölle
Obwohl die Zölle von den Importeuren und Konsumenten in den USA gezahlt werden müssen, sind die mittelständischen Exportunternehmen sowohl direkt als auch indirekt von der US-Zollpolitik betroffen. Ob und in welchem Ausmaß dies tatsächlich geschieht, hängt jedoch vor allem vom Spezialisierungsgrad der konkreten Ware oder Dienstleistung ab. Je innovativer und passgenauer die Lösungen sind, die die mittelständischen Unternehmen vor allem im Business-to-Business-Bereich für ihre US-Kunden erstellen, desto eher können sie ihre (Netto-)Preise trotz Zoll stabil halten. Tatsächlich trifft genau das für viele mittelständische Unternehmen zu. Aufgrund enger und langjähriger Beziehungen zu ihren Abnehmern erstellen sie kundenspezifische Güter und Dienstleistungen, die einen hohen Nutzen generieren und nicht so leicht ersetzt werden können.
Von den erhöhten US-Zöllen sind vor allem diejenigen mittelständischen Unternehmen stark betroffen, die weitgehend standardisierte Produkte anbieten. Bei ihnen kann sich der nun vereinbarte Zollsatz von 15% auf die erzielbaren (Netto-)Preise und Absatzmengen auswirken. Gleichwohl gibt es auch Effekte, die diese Entwicklung abfedern könnten: Gehen beispielsweise im Zuge der US-Zollpolitik die Warenimporte in den USA zurück, kann dies zu einer Aufwertung des US-Dollar im Vergleich zum Euro führen. Dadurch würden sich die in Euro umgerechneten Umsätze der mittelständischen Exporteure auf dem US-Markt tendenziell erhöhen.
Unabhängig davon könnte der Mittelstand in Deutschland aber auch von einer geringer werdenden Wettbewerbsfähigkeit der US-amerikanischen Anbieter profitieren, da sich ceterus paribus die Vorleistungen für US-amerikanische Unternehmen verteuern. Allerdings wirkt sich dieser Effekt auch auf die weltweiten Lieferketten aus: Werden Vorprodukte zollbedingt dauerhaft wesentlich teurer, werden sich die Leadunternehmen nach neuen Zulieferern umsehen müssen. Aktuell trifft dies z. B. (mittelständische) Unternehmen, sofern sie in der Stahl- und Aluminiumindustrie tätig sind und weiterhin 50% Zölle auf deren Waren in den USA erhoben werden. Zukünftig könnten hiervon auch (mittelständische) Zulieferer der US-amerikanischen Pharmaindustrie betroffen sein, da dieser Bereich explizit aus der aktuellen Handelsvereinbarung zwischen EU und USA ausgenommen wurde.
Je mehr mittelständische Unternehmen von diesen negativen direkten und indirekten Entwicklungen in Folge der US-Zollpolitik getroffen werden, desto mehr werden sie ihre Auslandsaktivitäten Richtung USA reduzieren. Tendenziell wird dies häufiger bei kleineren mittelständischen Unternehmen zu beobachten sein als bei Großunternehmen, da letztere über deutlich größere Ressourcen verfügen und diversifizierter aufgestellt sind.
Hinzu kommt, dass die Zollpolitik der US-Administration von einem erratischen, schwer vorhersehbaren Vorgehen geprägt ist. Dadurch werden die (zukünftigen) Export-, Standort- und Investitionsentscheidungen der Unternehmen gleichfalls erschwert. Wenn jedoch kleinere Unternehmen aus einem Auslandsmarkt ausscheiden, werden sie es sich zu einem späteren Zeitpunkt mehrfach überlegen, ob sie ihre Auslandsaktivitäten via USA wieder ausdehnen, zumal sich in der Zwischenzeit die wichtige „Marktfühlung” verringert haben könnte und Lieferbeziehungen neu aufgebaut werden müssen.
Aber auch auf dem deutschen und EU-Binnenmarkt können den mittelständischen Unternehmen aktuell wettbewerbliche Nachteile dadurch entstehen, dass beispielsweise China sein Absatzvolumen, das im Zuge des reduzierten US-Handels freigeworden ist, zu niedrigen (Dumping-)Preisen nach Europa schickt.
Gleichwohl wird auch weiterhin der EU-Binnenmarkt der wichtigste Beschaffungs- und Absatzmarkt für die mittelständischen Unternehmen in Deutschland bleiben. Schließlich bietet er eine hohe Rechtssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen für alle europäischen Unternehmen. Unabhängig davon sollte die Europäische Union nun aber die Chance nutzen und mit anderen Staaten und Ländergruppen Freihandelsverträge schließen, die gleichfalls angesichts der US-Zolldrohungen verlässliche und handelserleichternde Rahmenbedingungen bieten. Im günstigsten Fall kann die EU so ihren Ruf als verlässliche und auf fairen Interessenausgleich ausgerichtete „Insel der Stabilität” stärken.
Auch sollten insbesondere die kleineren mittelständischen Unternehmen dafür sensibilisiert werden, ihre Auslandsaktivitäten in Länder mit geringen wirtschafts- und handelspolitischen Risiken (z. B. die Europäische Freihandelsassoziation EFTA) auszudehnen.
Zu den Autoren:
Friederike Welter ist Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn und Professorin an der Universität Siegen.
Hans-Jürgen Wolter arbeitet als Projektleiter im IfM Bonn.
Michael Holz ist Wissenschaftler im IfM Bonn.
Hinweis:
Eine umfassende Analyse der Auswirkung der unilateralen US-Zollpolitik auf die Auslandsaktivitäten des Mittelstands in Deutschland finden Sie im Hintergrundpapier „Der Mittelstand angesichts der US-Zölle” auf der Internetseite des IfM Bonn.