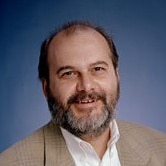Nat Dyers neues Buch Ricardo’s Dream ist außerordentlich schwierig zu rezensieren. Nicht, weil die Hauptthese unklar oder es zu kompliziert geschrieben wäre. Sondern weil es meiner Meinung nach eine sehr vernünftige Kritik der neoklassischen Ökonomik mit absolut unhaltbaren oder falschen Behauptungen verbindet und eine ähnliche Blindheit gegenüber der Realität an den Tag legt, wie sie bei anderen beanstandet wird.
Dyers These ist denkbar einfach. Die „Erbsünde” der Wirtschaftswissenschaften liegt in der unhinterfragten Akzeptanz von David Ricardos abstraktem Analysemodell, das auf der Annahme eines rationalen (Dyer bevorzugt „kalkulierenden”) eigennützigen Individuums beruht. Ricardos Methode, die sich am bekanntesten in seiner Theorie des komparativen Vorteils widerspiegelt, wurde schon bei der Veröffentlichung von The Principles of Political Economy im Jahr 1817 kritisiert (und sogar noch früher, als Ricardo es gerade schrieb). Nichtsdestotrotz hat sie unter den Hohepriestern John Stuart Mill und Alfred Marshall überlebt, die sie etwas selbstgefällig (vor allem letzterer) übernommen und angewandt haben.
Dyer springt dann ein Jahrhundert weiter und begibt sich in die Vereinigten Staaten, wo Milton Friedman und die zweite Chicagoer Schule sowie Paul Samuelson ebenfalls daran glaubten und es förderten, und wo die Liebe der Ökonomen zur Abstraktion und zu sauberen, klaren, einfachen Wahrheiten zur Missachtung gesellschaftlicher Zwänge und zu einem blinden Glauben an einen berechnenden Homo oeconomicus führte. Dies resultierte in der Finanzialisierung der US-Wirtschaft, zur Globalisierung, die der amerikanischen Mittelschicht schadete, zur Finanzkrise von 2007-08, zur Zerstörung der Umwelt, zum Aufstieg des Populismus und – so wird stillschweigend unterstellt – beinahe zum Ende der westlichen Zivilisation.
Die Geschichte wird von Dyer einigermaßen gut erzählt. Es gibt Kapitel, die es wert sind, gelesen zu werden: vor allem im ersten Teil des Buches, der sich mit Ricardos Leben befasst und mittels interessanter Details zeigt, wie der englisch-portugiesische Handel, den Ricardo bei der Formulierung seiner Theorie des komparativen Vorteils als Beispiel anführte, selbst Teil eines viel größeren Geflechts von politischen Bündnissen, Kriegen, Kolonialismus und Sklaverei war. Dieses Kapitel ist nicht deshalb lesenswert, weil es, wie Dyer zu glauben scheint, Ricardos Theorie widerlegt (denn Ricardos Beispiel würde für die Länder A und B und die Waren X und Y gleichermaßen gelten), sondern wegen seines wirtschaftsgeschichtlichen Blickwinkels und wegen der Hintergründe des anglo-portugiesischen Methuen-Vertrags, einschließlich der Sklaverei und der Plünderung des brasilianischen Goldes. Diese Aspekte sind meines Erachtens nicht sehr bekannt und werden von Dyer in der Tat sehr eindringlich und zuweilen sogar kraftvoll beschrieben.
Meine Rezension wird kritischer ausfallen, als es das Buch selbst verdient, weil ich Dyers Buch als sinnbildlich für die Art und Weise halte, wie westliche Liberale und sogar linke Denker die Geschichte und die heutige Globalisierung betrachten.
Ich sehe zwei Punkte grundsätzlich anders als Dyer. Der erste bezieht sich auf den „Vorwurf” an Ricardo, der den roten Faden des Buches bildet. Wie bereits erwähnt, ist der Vorwurf der Abstraktheit alles andere als neu und sogar grosso modo verdient. Dyer vergisst jedoch in voller Übereinstimmung (und womöglich unbewusst) mit den Neoklassikern, dass Ricardos abstrakte Analysemethode sich auch in seiner Einführung des Klassenkonflikts als entscheidendem Teil der Ökonomie im Kapitalismus widerspiegelte. Es ist daher nicht überraschend, dass Ricardo sozialistische Ricardianer, Marx (für den Ricardo, wie Schumpeter schreibt, der einzige „Lehrer” war), Neomarxisten und Neoricardianer folgten. Sie alle lehnten die neoklassische Ökonomie entschieden ab und stützten sich dabei genau auf Ricardos Methode und seine Klassenanalyse. Letztere wurde aus der neoklassischen Ökonomie vollständig entfernt, meist aus politischen Gründen, was die neoklassische Ökonomie von der Realität abkoppelte (wie ich in Visions of Inequality, Kapitel 7, darlege).
Damit verfehlt Dyer leider den entscheidenden Punkt: Ricardo mag sich eines übertriebenen abstrakten Denkens schuldig gemacht haben. Aber genau dieses abstrakte Denken hat einen viel realistischeren Ansatz für die politische Ökonomie möglich gemacht – nämlich einen, bei dem die Klassen um die Verteilung des Volkseinkommens kämpfen und bei dem Macht und Einfluss eine Rolle spielen. Um es einfach auszudrücken: Ohne Ricardo (und Adam Smith) und die Klassenanalyse gäbe es keine realistische Darstellung einer kapitalistischen Wirtschaft.
Dyer ist, wie die meisten heutigen liberalen Kritiker, so tief in der neoklassischen Ökonomie verwurzelt (von der er lediglich die Annahme des „Homo oeconomicus” kritisiert), dass er die größte Schwäche des neoklassischen Ansatzes nie erwähnt: die Vernachlässigung der Klassenstruktur kapitalistischer Gesellschaften. Auch wenn man zu Recht eine gewisse Verbindung zwischen Ricardos Methode und z.B. Robert Lucas sieht, kann Ricardo nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Neoklassiker diese Methode weit über jede vernünftige Grenze hinausgetrieben haben, und auch Ricardos Rolle bei der Darstellung der zentralen Bedeutung der Klasse in der kapitalistischen Wirtschaft kann nicht so einfach abgetan oder ignoriert werden, wie es in Dyers Buch der Fall ist.
Das Problem liegt nicht in der Annahme des rationalen Individuums, die vor allem in den heutigen hochgradig kommodifizierten Gesellschaften, die von zahlenkundigen Individuen bevölkert werden, durchaus realistisch ist, sondern in der Ablehnung der sozialen Klasse als sinnvolle Analyseeinheit. Es ist also nicht so, dass wir zu viel von Ricardo haben. Wir haben zu wenig von ihm.
Das zweite linksliberale „emblematische” Merkmal des Buches, mit dem ich nicht einverstanden bin, ist dass die gegenwärtige Globalisierung (im letzten Teil des Buches) ausschließlich aus westlicher Sicht erfolgt. Das Kapitel darüber, wie die Globalisierung zur Verschlechterung der Lage der westlichen Mittelschicht geführt hat (was wahr ist), wird ohne eine einzige Erwähnung dessen erzählt, was die Globalisierung den armen Menschen in der Welt und vor allem in Asien ermöglicht hat. Die Probleme der westlichen Mittelschicht, d. h. der Menschen, die etwa das 80. oder sogar 90. globale Einkommensperzentil erreichen und etwa 3 bis 4% der Weltbevölkerung ausmachen, werden so dargestellt, als ob sie für das gesamte Universum gelten würden. Es wird so getan, als ob nicht fast eine Milliarde Menschen dank des Wirtschaftswachstums und der Globalisierung aus der bitteren Armut herausgeführt worden wären.
In diesem Teil des Buches wird die Geschichte nicht nur ausschließlich aus angloamerikanischer Sicht erzählt, sondern der Text nimmt auch beunruhigende nationalistische Züge an, wenn die einzige Erwähnung Chinas und der Globalisierung im Zusammenhang mit „der Herausforderung des….aufstrebenden Chinas” (S. 206) erfolgt. Plötzlich ist nur noch die Geopolitik wichtig. Diese national-sozialistischen Töne sind umso interessanter, aber in der liberalen Linken nicht unüblich, als sie mit der ganzen Bandbreite der politischen Korrektheit verbunden sind, in der jedes Zitat von Smith oder Ricardo wiederholt als nicht geschlechtsneutral kritisiert wird und die „thought police” auf 200 Jahre alte Schriften angewandt wird.
Dyer präsentiert eine sehr verbreitete Sichtweise der anglo-amerikanischen liberalen Intelligenzija, in der scharfe Kritik am britischen Imperialismus gleichzeitig mit völliger Unkenntnis der ökonomischen Arbeiten nicht-anglophoner Ökonomen und, was noch wichtiger ist, der Arbeiten westlicher und nicht-westlicher Ökonomen, die nicht in der neoklassischen Tradition stehen, vorgetragen wird. Darüber hinaus wird die derzeitige Konvergenz der Welteinkommen ausschließlich als ein Übel dargestellt, das die westliche Mittelschicht zerstört hat. Es scheint, als ob eine scharfe Kritik am Kolonialismus ausreicht, um sich von jeglichem westlichen Zentrismus in der Gegenwart freisprechen zu können. Die Kritik am Kolonialismus wird so zu einem rituellen Akt, der den Lesern sagt, dass man heute mit gutem Gewissen ein Wirtschaftsnationalist sein kann.
Um es klar zu sagen: Ich glaube nicht, dass diese Perspektive falsch ist, wenn sie von Politikern oder Wirtschaftswissenschaftlern eingenommen wird, die sich mit Fragen der nationalen Wirtschaftspolitik befassen und die sich legitimerweise in erster Linie um das Wohlergehen ihrer eigenen Mitbürger kümmern, und möglicherweise nur darum. Aber diese Perspektive ist inakzeptabel, wenn sie von Wirtschaftswissenschaftlern eingenommen wird, deren Interesse, wie Smith, Ricardo und Marx gezeigt haben, die ganze Welt umfassen muss und jedem Individuum, wo auch immer es lebt, implizit das gleiche Gewicht einräumt, wenn sie entscheiden, welche Politik gut oder schlecht ist.
Zum Autor:
Branko Milanovic ist Professor an der City University of New York und gilt als einer der weltweit renommiertesten Forscher auf dem Gebiet der Einkommensverteilung. Milanovic war lange Zeit leitender Ökonom in der Forschungsabteilung der Weltbank. Er ist Autor zahlreicher Bücher und von mehr als 40 Studien zum Thema Ungleichheit und Armut. Außerdem betreibt er den Substack Global Inequality and More 3.0, wo dieser Beitrag zuerst in englischer Sprache erschienen ist.