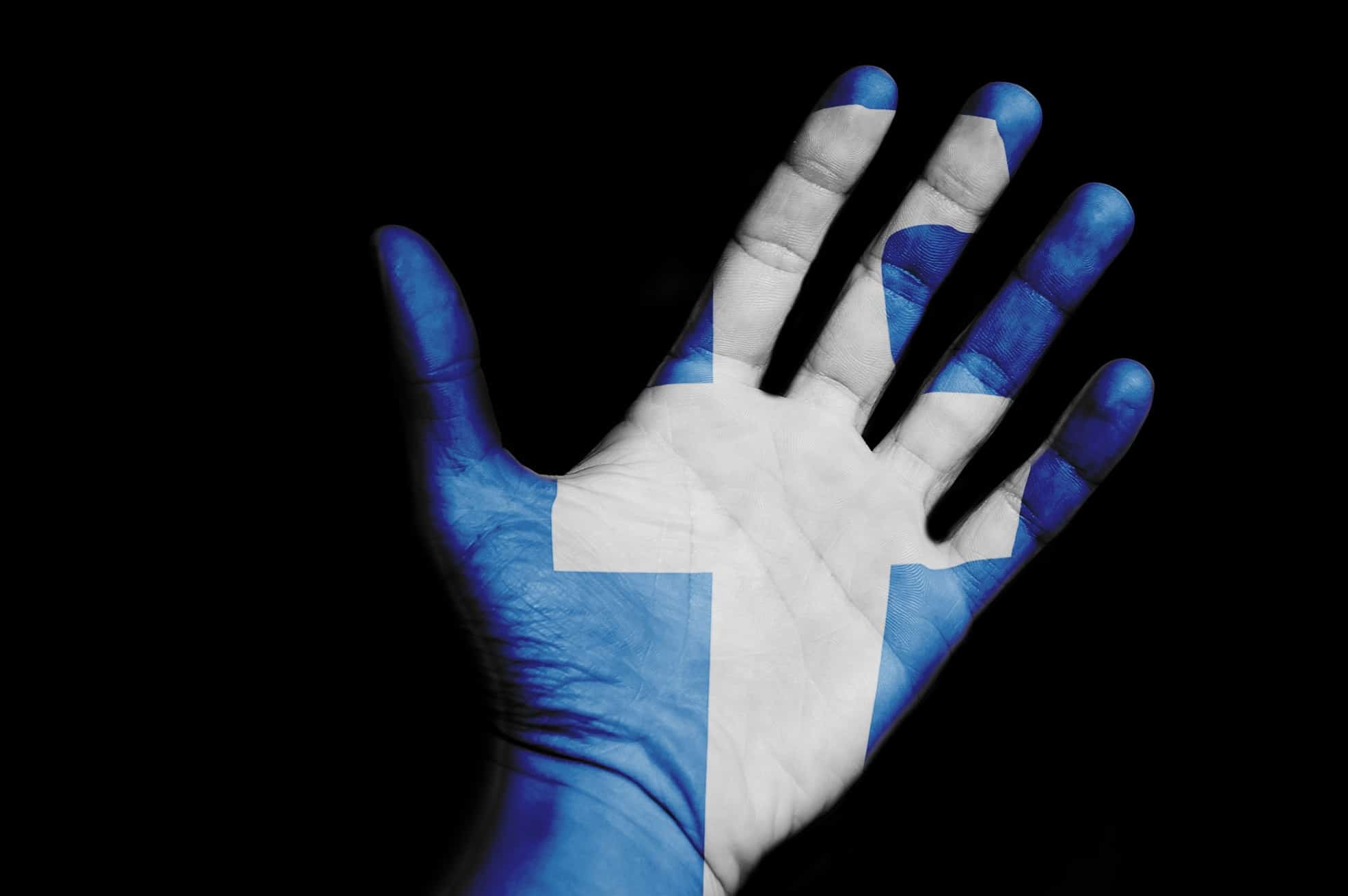Wir alle sind online, wir alle sind ständig erreichbar, unser Smartphone weiß genauer wo wir uns befinden als unser Partner. Wir whatsappen, facebooken, twittern und manch einer von uns checkt hin und wieder seinen Klout-Score als vermeintlich ultimativen Beweis, dass er den Social Media-Tod noch nicht gestorben ist. Wir alle hinterlassen unzählige Datenspuren, bewusst wie unbewusst, und trösten uns damit, dass wir ja nichts zu verbergen haben. Und wenn wir uns in der realen Welt bewegen, bewegen wir uns mit der Smartwatch und mit Uber – überall fließen Datenströme.
Dabei bleibt die Grundfrage ungeklärt: Wem gehören eigentlich die Daten? Tatsache ist: Wir übereignen unsere Daten in der Regel entgeltlos in Erwartung einer Dienstleistung und vertrauen darauf, dass uns die AGBs vor Missbrauch schützen. Dass dies die falsche Einstellung ist, zeigen nicht nur die Experimente der chinesischen Regierung mit einem „System für Soziale Vertrauenswürdigkeit“, das sich unter anderem auch aus sozialen Medien speist, oder zuletzt der Cambridge Analytica-Skandal.
Die AGBs der sozialen Medien erkennen wir durch das Klicken auf einen Zustimmungsbutton an. Eine Chance, sie unseren Bedürfnissen anzupassen, haben wir nicht. Annahme oder Akzeptanz – dabei sein oder nicht, einen Mittelweg gibt es nicht. Der unausgesprochene Trade-Off heißt Privatsphäre gegen Bequemlichkeit, Dateneigentum gegen Anwendung.
Genossenschaft statt Datenkapitalismus
Wer sagt aber, dass es bei diesem Datenkapitalismus bleiben muss? Warum sollte den Datengebern, also den Nutzern, nicht ein Anteil an der Plattform gehören?
Einen guten Anknüpfungspunkt dafür bietet die Rechtsform der Genossenschaft: In einem solchen Modell würde die Plattform den Nutzern, und nicht den Betreibern gehören. Genossenschaftsanteile und damit Eigentums- wie Stimmrechte erhalten die Teilnehmer anteilig nach dem Datenvolumen, das sie generieren. Entsprechend werden sie auch anteilig am Gewinn beteiligt.
Um zu verhindern, dass Daten um ihrer selbst willen generiert werden, könnten Beurteilungskriterien wie „Likes“, Weiterempfehlungen, Klout-Scores etc. als zusätzliche Gewichtung hinzugezogen werden. Das Bewertungsverfahren bestimmen die Nutzer, also die Eigentümer. Wer Datenmüll produziert oder nicht aktiv ist, hat keinen Anteil am Ertrag.
Die Plattformbetreiber selbst sind nicht mehr die Eigentümer, sie sind die Dienstleister, welche die (Fort-)Entwicklung der Technologie, das Marketing, den Datenschutz, die Speicherkosten etc. entlohnt bekommen, etwa als Gewinnanteil. Da sie im Wettbewerb mit anderen Plattformen stehen, haben sie ein Interesse, die beste Dienstleistung zum besten Preis anzubieten.
Der Wettbewerb als „herrschaftsfreier Kontrollmechanismus“
Damit es zu wirklichem Wettbewerb unter den Dienstleistern, also den Anbietern genossenschaftlich organisierter Plattformen kommt, und nicht zu Monopolen oder zumindest Kartellen, welche dann wiederum ihre Gebühren hoch bzw. die genossenschaftlichen Ausschüttungen runter schrauben könnten, ließe sich die Konnektivität der Plattformen untereinander durch den Rechtsrahmen gewährleisten: Nicht nur die privaten Profile und Daten sind per Mausklick auf einen anderen Anbieter übertragbar (sie befinden sich ja im Privateigentum), die Mitglieder selbst können sich untereinander verbinden. Konkret: Wer auf Facebook ist, kann sehen, was mit ihm verbundene Xing- oder Twitter-Mitglieder posten und umgekehrt, sofern dies im gegenseitigen Einverständnis geschieht. Denn warum sollte bei sozialen Netzwerken nicht funktionieren, was beim Emailen von Beginn an der Standard war: Jeder kann mit jedem kommunizieren, egal welchen Anbieter er nutzt.
Die Daten-Genossenschaft beruht dabei auf zwei rechtlichen Grundpfeilern:
- Dem Grundsatz der Datenhoheit: Die Daten gehören den Nutzern, nicht den Plattformen. Entsprechend bestimmen die Nutzer, wie und ob diese Daten erhoben, gespeichert, ausgewertet oder mit anderen Datensätzen verbunden werden. Das Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“, wie es vom deutschen Bundesverfassungsgericht vorgegeben wurde, bietet die Grundlage dafür. Dieses spricht dem Einzelnen zu, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen.
- Dem Grundsatz des Wettbewerbs, der den „herrschaftsfreien Kontrollmechanismus“ gewährleistet, wie ihn Franz Böhm beschrieben hat.
Paradigmatisch geht es also um die Verbindung einer alt-bewährten Rechtsform, der Genossenschaft, mit den Anforderungen der Netzökonomie. Es geht um die „Facebook-Genossenschaft“, genauer die Daten-Genossenschaften.
Die technischen Möglichkeiten dafür sind längst vorhanden: Da Daten überall fließen, könnten unterschiedliche Genossenschaften gegründet werden, oder die Nutzer eine ID bekommen, die auch ihre Privatsphäre garantieren würde. In Verbindung mit der Blockchain-Technologie wird gewährleistet, dass die Erträge der von ihnen generierten Daten auch ihnen selbst zufließen.
Vorteile von Datengenossenschaften
Die Vorteile von Datengenossenschaften wären:
- Dateneigentum: Das Eigentumsrecht an den persönlichen Daten ist eindeutig geklärt. Die Daten gehören dem, durch den sie entstehen. Den Eigentümern fließen die Erträge daraus zu. Die Privatsphäre wird durch eine ID gewährleistet.
- Verfallsdatum: Wie lange die Daten gehortet werden, kann das Genossenschaftsmitglied selbst bestimmen. Denkbar wäre beispielsweise ein einfacher Trade-Off: Je kürzer deren Lebenszeit, desto geringer ist der Genossenschaftswert und desto geringer fallen die anteiligen Erträge aus der Genossenschaft für den Nutzer aus – desto größer ist aber auch seine Hoheit über die eigene Privatsphäre und der Schutz vor Datenmissbrauch, z.B. im Falle von Hackerangriffen.
- Kontrolle: Die Daten-Genossenschaft wird zum Club-Gut. Es nicht mehr egal, wer alles beitritt, da der gemeinsame Nutzen durch den Zutritt unerwünschter Mitglieder – z.B. auf Facebook – sinken könnte, wenn der eigene Ruf darunter leidet oder Werbepartner abspringen. Das fördert die Kontrolle durch die Mitglieder: Wer tritt bei und wird damit Genosse? Wer fördert den gemeinsamen Nutzen? Wer zirkuliert „FakeNews“ und propagiert Hassreden? Ein Ausschluss derer ist zu erwarten, die den Wert der Genossenschaftsanteile senken.
Retten den Kapitalismus vor der Kapitalkonzentration
Und natürlich der wohl wichtigste Vorteil: Wenn es keine alleinigen Besitzer der Daten mehr gibt, oder Aktiengesellschaften, bei denen das Kapitaleigentum von der Zurverfügungstellung der Daten getrennt ist, wirkt dies der Kapitalkonzentration entgegen. Die Losung lautet also: Rettet den Kapitalismus vor der Kapitalkonzentration, wobei Kapitalismus hier nicht als ideologischer Kampfbegriff, sondern als auf Privateigentum beruhende Gesellschaftsform verstanden wird. Denn auch im Internet zerstören Kapitalkonzentration und fehlender Wettbewerb die Marktwirtschaft.
Die „Facebook-Genossenschaft“ kann uns – 200. Jahre nach dem Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem Begründer der Genossenschaften – den Weg in die Netzökonomie weisen.
Zum Autor:
Hans-Jörg Naumer ist Leiter der Abteilung Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors. Auf Twitter: @NaumerOekonom