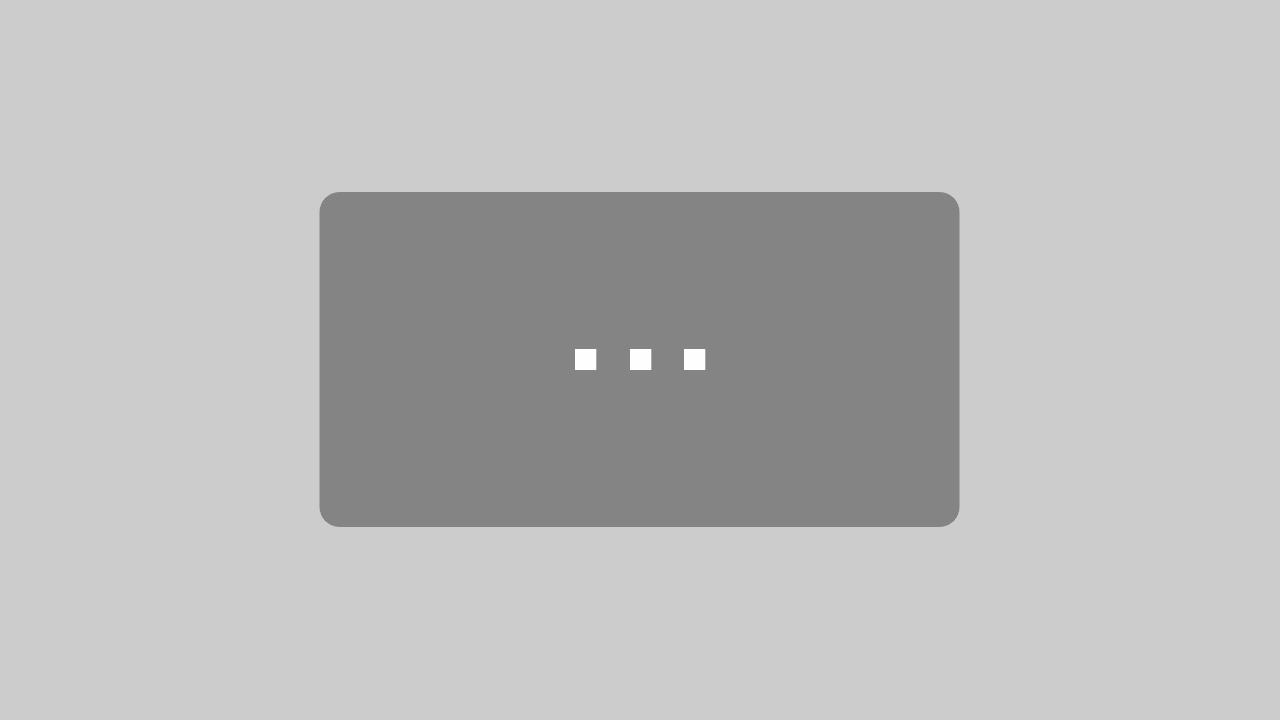Vor einigen Wochen schrieb Seema Jayachandran in der New York Times darüber, wie positives Denken, Hoffnung und Optimismus möglicherweise als Strategie zur Armutsbekämpfung genutzt werden könnten. Die Ökonomin von der Northwestern University diskutierte eine Reihe von Studien, die die positiven Wirkungen von Hoffnung und Optimismus auf zukunftsgerichtetes Verhalten benachteiligter Menschen belegen sollen – warnte jedoch auch davor, zu viel Hoffnung in diese Strategie zu setzen.
In der Tat gibt es gute Gründe, die Rolle von Hoffnung und positivem Denken bei der Bekämpfung von Armut nicht überzustrapazieren. Ich möchte nicht bestreiten, dass ein optimistischer Blick in die Zukunft einen Beitrag zur Reduktion von Armut und für die Verbesserung der Lebensqualität im Allgemeinen leisten kann. Aber diese Faktoren können nur als Teil einer breiteren Strategie zur Armutsbekämpfung sinnvoll sein. In einer solchen Strategie müssen immer auch strukturelle Ursachen von Armut berücksichtigt werden, die nichts mit positivem oder negativem Denken zu tun haben.
Jayachandran beschreibt mehrere Experimente, die untersuchen, wie die Stimulierung von optimistischen Zukunftsplänen, Hoffnung und Selbstwert von in Armut lebenden Menschen zu einer Verbesserung von deren Lebenssituation führen konnten. Eine Studie aus Uganda untersuchte beispielsweise, wie sich der Film „Queen of Katwe“ auf Schülerinnen und Schüler und deren Motivation auswirkte. Der Film zeigt die Geschichte eines Mädchens aus einer armen Familie in Kampala, die erfolgreich Schach spielt und weltweit Wettkämpfe gewinnt, wodurch sie ihr Leben und das ihrer Familie zum Besseren wenden kann. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Schülerinnen und Schüler durch diesen Film motivierter und optimistischer wurden und deswegen bei Prüfungen besser abschnitten.
Aus einem anderen Experiment aus Mexiko ging ebenfalls hervor, dass Motivation und Verhalten durch Filme beeinflusst werden können. In diesem Fall wurde indigenen Frauen ein Dokumentarfilm gezeigt. Er berichtet von Frauen aus ähnlichen Hintergründen, die erfolgreich einen Mikrokredit zur Verbesserung ihrer Lebenssituation genutzt hatten. Darüber hinaus nahmen die Frauen vier Wochen lang an einem sogenannten Hope Curriculum teil, einem Programm, in dem sie sich selbst Ziele setzten und sich dann vorstellten, wie das Erreichen dieser Ziele ihr Leben verbessern würde. Die Studie zeigt, dass diese Intervention die Zukunftshoffnungen und -pläne der Frauen ambitionierter machte.
Risiken und Nebenwirkungen
Zurecht bezeichnet Jayachandran den Umstand, dass das einmalige Anschauen eines Films zu messbaren Veränderungen im Verhalten führt, als bemerkenswert. Gleichzeitig wendet sie ein, dass Hoffnung natürlich kein Allheilmittel ist und alleine wohl keine Verbesserung bewirken kann, wenn es an Fähigkeiten oder finanziellen Ressourcen mangelt. Weiterhin erwähnt sie, dass zu ambitionierte und unrealistisch hohe Aspirationen sich sogar ins Negative verkehren können. Diese Punkte stehen nicht im Mittelpunkt von Jayachandrans Darstellung, können jedoch nicht oft genug betont werden: Oft scheinen die oben zitierten Studien mit überschwänglichem Optimismus und auch Naivität aufgenommen zu werden.
Beispielsweise evaluiert die Weltbank im World Development Report 2015 ein weiteres Experiment, das ebenfalls darauf abzielt, durch einen Film die Zukunftspläne von in Armut lebenden Menschen in Äthiopien zu beeinflussen. Ohne Risiken und Nebenwirkungen zu erwähnen wird im Bericht gelobt, wie die Intervention in der Lage gewesen sei, mentale Modelle sowie die Vorstellung der Menschen darüber, was in der Zukunft möglich ist, zu verändern. Die vielen Gründe, von einer solchen eintägigen Intervention nicht zu viel zu erwarten, geraten allzu oft in den Hintergrund. Das Risiko ist daher groß, dass die möglichen Effekte solcher Interventionen überschätzt und mögliche Nebenwirkungen unterschätzt werden.
Das Hauptrisiko ist aus meiner Sicht Folgendes: Wenn die Bedeutung von Selbstbildern, Weltanschauungen und Einstellungen zu stark betont wird, geraten strukturelle Gründe für das Entstehen und Fortbestehen von Armut leicht in den Hintergrund. Menschen sind jedoch nicht arm nur, weil sie ein geringes Selbstbewusstsein haben oder pessimistisch auf ihre Zukunft schauen.
Natürlich können ein geringes Selbstbewusstsein oder Pessimismus eine Begleiterscheinung und auch Konsequenz von Armut sein, und natürlich können sie auch dazu beitragen, dass die Überwindung von Armut noch schwieriger wird. Aber sie sind sicherlich nicht die einzige und wahrscheinlich auch nicht die Hauptursache von Armut. Somit wäre es fehlgeleitet zu suggerieren, dass diese allein maßgeblich in der Lage wären, Armut in einem signifikanten Maß zu bekämpfen – Armut ist in erster Linie ein strukturelles und gesellschaftliches Problem, kein individuelles. Das soll kein Grund sein, Optimismus und ein gutes Selbstwertgefühl nicht zu betonen – schon allein, weil sie an sich wertvoll sind und zu einem guten Leben beitragen. Was ihre instrumentelle Wirkung im Hinblick auf Armutsbekämpfung betrifft, gibt es aber gleich mehrere Einschränkungen.
Objektive und subjektive Möglichkeiten-Sets
Das Veränderungspotenzial von Optimismus und Hoffnung ist gering, wenn Menschen in Armut leben und somit in ihren materiellen Lebensgrundlagen eingeschränkt sind. Unterschiedliche Menschen haben verschiedene Möglichkeiten-Sets, die von ihren Lebensbedingungen geprägt sind. Man kann zwischen einem objektiven und einen subjektiven Möglichkeiten-Set unterscheiden (die lange Version des Arguments finden Sie hier).
Das objektive Set besteht aus allen Möglichkeiten, die einer Person faktisch offenstehen. Es ist begrenzt von „harten“ Faktoren wie Budgetrestriktionen oder nicht unmittelbar verhandelbaren sozialen Regeln, zum Beispiel wenn bestimmte Optionen bestimmten Gruppen verwehrt sind. Ein Leben in Armut bedeutet, dass die objektiven Möglichkeiten empfindlich eingeschränkt sind – und dies kann nicht durch positives Denken verändert werden, schon gar nicht kurzfristig.
Positives Denken ist im Hinblick auf das subjektive Möglichkeiten-Set von Interesse. Dieses beinhaltet alle jene Möglichkeiten aus dem objektiven Set, die eine Person effektiv für sich in Betracht zieht. Wenn das subjektive Set nur eine kleinere Untermenge des objektiven ist, gibt es einige Möglichkeiten, die einer Person zwar offenstehen, die diese aber nicht in Betracht zieht (in der Literatur wird diese Situation als aspiration trap bezeichnet). Eine solche Situation könnte beispielsweise entstehen, wenn ein sehr geringes Selbstbewusstsein, antizipierte Diskriminierung oder eine Reihe anderer psychologischer und kognitiver Faktoren dafür sorgen, dass eine Person ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten zu zurückhaltend einschätzt.
Konkret könnte es etwa passieren, dass eine Studentin aus einem armen Haushalt zwar objektiv betrachtet die Fähigkeiten und Ressourcen hätte, ein Studium zu absolvieren, sich dieses aufgrund fehlender Vorbilder oder bestehender sozialer Vorurteile aber schlichtweg nicht zutraut. Wenn eine Verhaltensintervention diese Haltung infrage stellt, könnte dies dazu führen, dass das subjektive Möglichkeiten-Set dem objektiven angeglichen wird.
Die in Jayachandrans Artikel genannten Interventionen und ihre Effekte sind wahrscheinlich dieser Natur: Sie haben dazu geführt, dass Menschen motivierter waren, ihnen bereits offenstehende Möglichkeiten wahrzunehmen. Es haben sich jedoch nicht die ihnen offenstehenden Möglichkeiten an sich verändert – und eine solche Veränderung geschieht auch nicht durch Hoffnung oder Optimismus allein, zumindest nicht kurzfristig. Dafür sind wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen gefragt. Diese müssten übrigens nicht nur materielle Aspekte adressieren, sondern auch mentale Modelle in der Gesamtgesellschaft, zum Beispiel um diskriminierende Praktiken zu verändern, die dazu führen können, dass diskriminierte Gruppen ihre Fähigkeiten geringschätzen.
Zweitens kann die zu starke Betonung der positiven Effekte von Hoffnung und Optimismus politische Diskurse auf problematische Art und Weise beeinflussen. Wenn in Armut lebende Menschen anscheinend selbst verantwortlich für ihre Armut sind, weil sie unmotiviert, deprimiert, fatalistisch oder antriebslos zu sein scheinen, ist materielle Armut offensichtlich nicht das Kernproblem. Es wäre fatal, so gewissen Gruppen die Möglichkeit zu geben, arme Menschen selbst für ihre Armut verantwortlich zu machen – es ist eben nicht jeder „seines Glückes Schmied“.
Auch wenn dies von vielen Autor*innen und auch von Jayachandran nicht beabsichtigt ist, sollte viel klarer kommuniziert werden, wie die genannten Studien interpretiert werden können – und wie nicht. Dieser Punkt illustriert übrigens auch, welche Probleme entstehen können, wenn sich Politikmaßnahmen scheinbar automatisch evidenzbasiert ergeben, wie kürzlich von Jean Drèze kritisiert wurde. Um Politikmaßnahmen aus einzelnen Studien abzuleiten, müssen wir verstehen, welche Prozesse hinter einzelnen Ergebnissen stehen und über Ziele und Werte von Politik nachdenken. Naiv zu verkünden, dass positives Denken Armut reduzieren kann und entsprechende experimentelle Evidenz zu präsentieren, ohne auf Kontexte und weitere Implikationen einzugehen, kann zu Politiken führen, die letztendlich nicht im Interesse von in Armut lebenden Menschen sind.
Drittens, wo wir schon über Ziele und Werte von Politik sprechen: Wir sollten auch stärker darüber nachdenken, was genau die spezifischen Ziele möglicher Verhaltensinterventionen sind. Ein Aspekt ist der Zeithorizont: Wie lange kann der motivierende Effekt eines Films wohl andauern? Nachdem die ugandischen Schüler*innen es geschafft haben, durch ihre gesteigerte Motivation bessere Noten zu erzielen oder einen Studienplatz zu bekommen, werden in den nächsten Jahren sicherlich viele neue Hindernisse und Herausforderungen auf sie zukommen, die mit ihren persönlichen Hintergründen zu tun haben.
Leider erfahren wir wenig über die mittel- und langfristigen Effekte von Filmen wie „Queen of Katwe“. Verschiedene Arbeiten legen jedoch nahe, dass die potentiell negativen Effekte von gesteigerten Aspirationen viel stärker beachtet werden sollten, da kurzfristige Ambitionen mittel- und langfristig auch in Frustration umschlagen können. Beispielsweise gab es in Chile eine Zeit des sogenannten chilenischen Traums. In dieser Zeit waren chilenische Familien sehr optimistisch, was die Berufsaussichten ihrer Kinder anging, wenn sie sich nur gut genug um deren Ausbildung kümmern würden. Als sich herausstellte, dass die Situation am Arbeitsmarkt schwieriger war als angenommen, war ein großes Maß an Frustration und Enttäuschung die Folge.
Anstatt darauf abzuzielen, Aspirationen punktuell messbar zu steigern, sollten wir benachteiligte Menschen also stärker darin zu unterstützen, Agency und politische Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Das ist beispielsweise in einem von Ina Conradie und Ingrid Robeyns begleiteten Projekt geschehen: Die beiden Forscher*innen analysierten ein Entwicklungsprojekt in einem Township von Kapstadt, in dem Frauen sich über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig trafen, um über ihre Zukunftsaussichten, Möglichkeiten und Ziele zu sprechen und diese gemeinsam schrittweise zu avisieren. In gemeinsamen Diskussionen halfen sich die Frauen gegenseitig, Ziele zu artikulieren, die ihr Leben verbessern würden, aber auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten angesiedelt waren.
Das heißt nicht unbedingt, dass gegebene Möglichkeiten einfach hingenommen werden sollten: Vielmehr konnten die Frauen über die Identifikation von Einschränkungen individuelles und kollektives politisches Handeln entwickeln, das auf eine mittel- und langfristige Veränderung abzielte. Solche Ansätze zeitigen freilich weniger unmittelbare Effekte und sind inhärent politischer als ein unspezifisches Induzieren von Hoffnung für die Zukunft.
Zur Autorin:
Svenja Flechtner ist Juniorprofessorin für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen. Auf Twitter: @SvenjaFl
Der Beitrag ist zuerst in englischer Sprache beim Developing Economics-Blog erschienen.