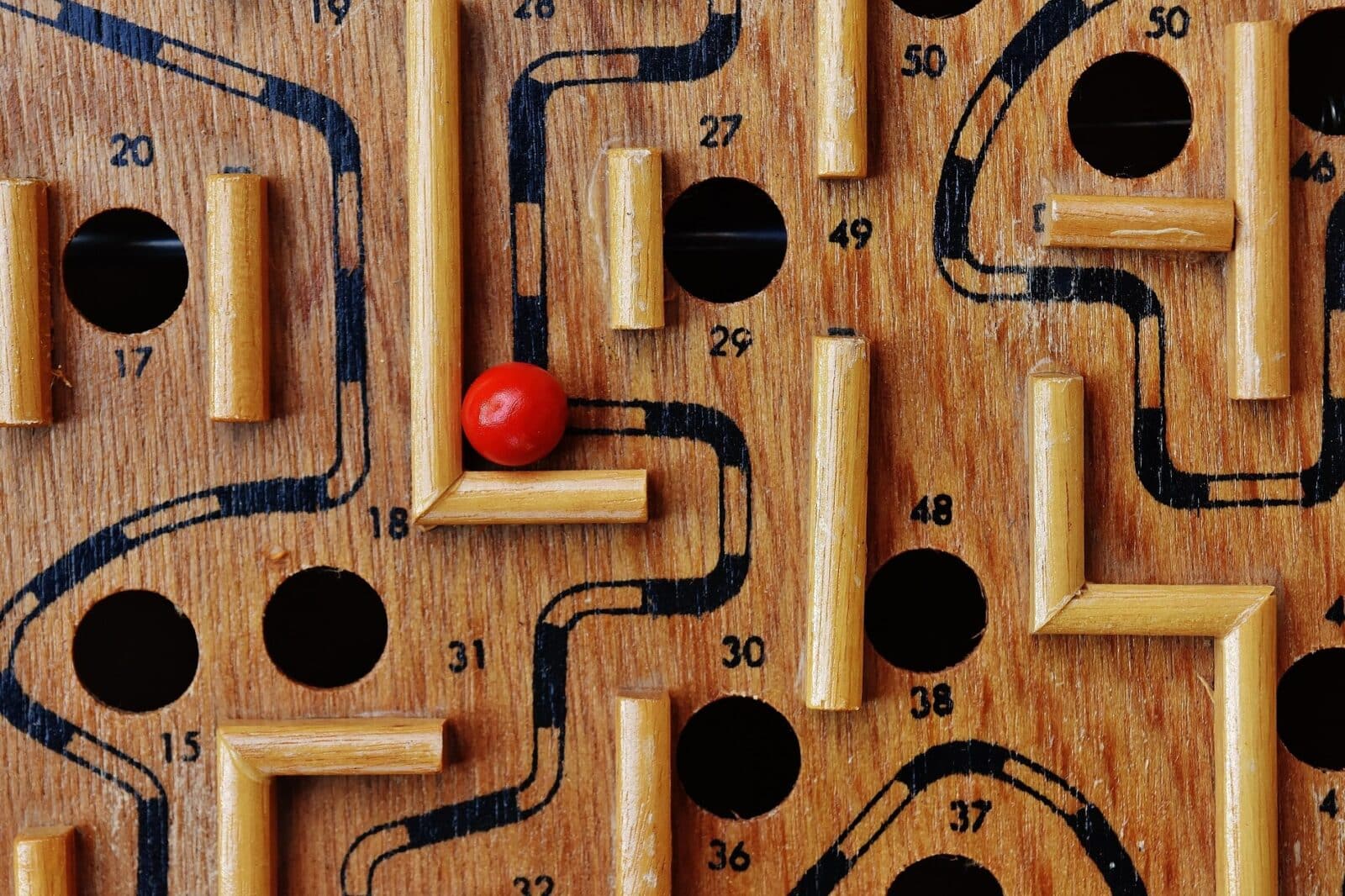In einem neuen Gutachten hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in der letzten Woche seine Position zu den jüngsten industriepolitischen Initiativen der EU dargelegt. In der umfangreichen Diskussion wird das Ringen um ein neues Verständnis von europäischer Industriepolitik erkennbar, das insbesondere den wachsenden handels- und geopolitischen Unwägbarkeiten Rechnung trägt. Dies betrifft insbesondere die Frage der Absicherung von Europas industrieller Transformation zu klimaneutraler Produktion.
Das Gutachten erkennt an, dass die EU in der Wahl ihrer wirtschaftspolitischen Instrumente Wehrhaftigkeit gegenüber unfairen Handels- und Subventionspraktiken von Drittstaaten demonstrieren muss. Zugleich betont die differenzierte Darstellung die Notwendigkeit einer fallspezifischen Politikbewertung, insbesondere bei der Abwägung zwischen dem Nutzen einer fokussierten Technologieförderung und den Vorteilen eines offenen Technologiewettbewerbs.
Wohltuend ist die Skepsis, mit der das Gutachten der Rhetorik der jüngsten EU-Industriepolitik begegnet. Kritisiert wird die inflationäre Verwendung des schwammigen Attributs „strategisch“ zur Rechtfertigung sektorspezifischer Fördermaßnahmen ebenso wie die Überbetonung des Resilienz-Gedankens zur Rechtfertigung von Marktinterventionen und sektoralen Detailvorgaben. Zurecht wird die zu beobachtende Vermischung von Klima- und Resilienz-Zielen in jüngsten EU-Gesetzesakten wie der Netto-Null-Industrie-Verordnung oder der Kritische-Rohstoffe-Verordnung als mögliche Quelle politischen Missbrauchs identifiziert.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die weitgehende Nicht-Berücksichtigung bestehender Trade-offs. So gehen die Erreichung der Klimaziele und der Aufbau heimischer grüner Lieferketten eben nicht zwangsläufig Hand in Hand: Werden die Stärkung der heimischen Produktion durch höhere Beschaffungspreise oder dauerhafte Subventionen für grüne Technologien bezahlt, wird der wirtschaftliche und politische Handlungsspielraum für die Dekarbonisierung zusätzlich begrenzt.
Klare Prinzipien, schwammige Empfehlungen
Deutlich vager bleibt das Gutachten in der Formulierung alternativer politischer Handlungsempfehlungen. Als grundlegende Anforderungen an eine europäische Industriepolitik werden die Notwendigkeit einer engen Abstimmung von gesetzlichen Zielen und Maßnahmen sowie der Vorrang marktkonformer Instrumente bei der Zielerreichung formuliert. Hinsichtlich der Zukunft der grünen Transformationspolitik wird die zentrale Rolle des EU-Emissionshandels betont. Zusätzliche Instrumente sollen nicht in Konkurrenz zur marktbasierten CO₂-Bepreisung treten oder diese gar unterminieren, sondern sie lediglich punktuell ergänzen.
Damit ist jedoch noch nicht präzisiert, wie die EU der zentralen externen Herausforderung für den europäischen Green Deal begegnen soll. Europa konkurriert auf den Märkten für grüne Technologien mit Ländern wie China, die schon rein institutionell mehr Freiheitsgrade bei der Gestaltung ihrer Industriepolitik besitzen – und diese auch konsequent nutzen. Auch wenn in dem Gutachten zu Recht auf die langfristigen Gefahren einer sektoralen (vertikalen) Industriepolitik hingewiesen wird, muss zugleich berücksichtigt werden, dass die globale Marktposition bei wenigen Schlüsseltechnologien in der gegenwärtigen Transitionsphase kritische Bedeutung für die zukünftige Teilhabe an grünem Wachstum haben wird.
Grüne Leitmärkte als Panazee für die Energiewende
Als Strategie zur Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen für europäische Unternehmen wird eine Abkehr von finanzieller Investitionsförderung zu Gunsten von Instrumenten zur direkten Beseitigung wettbewerblicher Kostennachteile gefordert. Für den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt werden dazu grüne Leitmärkte favorisiert, für Exportmärkte Instrumente zum Ausgleich der Nachteile aus heimischer CO2-Bepreisung.
In der Darstellung bleibt unklar, welchem genauen Verständnis der AutorInnen der schillernde Begriff „Leitmärkte” entspricht. Wenn sie den Vorstellungen der Europäischen Kommission folgen, solche Leitmärkte primär in Form neuer grüner Vergabekriterien in der öffentlichen Beschaffung zu implementieren, ist Marktkonformität mindestens zweifelhaft. Denn die Funktion solcher alternativer Vergabekriterien besteht ja gerade darin, die Rolle des Preises als Vergabekriterium und damit als Allokationsinstrument zurückzudrängen, um die anfänglich höheren Kosten grüner Produkte, wie wasserstoffbasierten Stahls, zu kompensieren.
Polit-ökonomisch bergen grüne Leitmärkte zudem bislang in der Debatte wenig beleuchtete Risiken. Anders als bei staatlichen Ausgaben für Investitionsförderung sind die gesellschaftlichen Mehrkosten erhöhter Preise in der öffentlichen Beschaffung nämlich nur schwer zu quantifizieren. Die sich alternativ ergebenden Beschaffungsausgaben bei Verzicht auf grüne Vergabekriterien sind nämlich kaum zu ermitteln, auch weil die Wahl der Kriterien Rückwirkungen auf das strategische Gebotsverhalten der Anbieter haben dürfte. Zudem verteilen sich im Falle weitflächig eingeführter Beschaffungskriterien die Mehrkosten auf eine große Zahl öffentlicher Institutionen unterschiedlicher Gebietskörperschaften. Gesellschaftliche Transformationskosten würden so von transparenten Budgetposten in eine Black Box verschoben. Das erzeugt Fehlanreize und erschwert das Monitoring der Energiewende.
Exportschutz bricht mit EU-Prinzipien
Angesichts der Lage auf den Exportmärkten ist die Forderung nach zusätzlichen Maßnahmen gegen Carbon Leakage nicht neu. Bereits bei der Ausarbeitung des EU-CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) wurde der fehlende Schutz europäischer Exporteure vor unfairem Wettbewerb mit CO₂-intensiv produzierenden Unternehmen aus Drittstaaten immer wieder als Manko hervorgehoben.
Die Frage ist, wie und ob überhaupt ein solcher dezidierter Exportschutz WTO-konform aufgesetzt werden kann. Eine einfache Fortführung des bisherigen Systems der generellen kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten an Carbon-Leakage-Sektoren wäre keine Option, da dies nicht WTO-konform wäre. So würden europäische Hersteller im Binnenmarkt gegenüber Importen, die dem CBAM unterliegen, bevorzugt. Angesichts der veränderten handelspolitischen Realitäten mag ein Bruch mit dem WTO-Regelwerk auch für die EU verlockend erscheinen. Dies stünde jedoch im Widerspruch zu ihrem Selbstverständnis als Garant multilateraler Verträge und zu ihrer eigenen Strategie, neue globale Handelsregeln durch Kooperation mit Partnerländern durchzusetzen. Durch die handelsumlenkenden Effekte von Carbon-Leakage-Ausgleichsmaßnahmen könnten gerade diejenigen potenziellen Partner ökonomisch in Mitleidenschaft gezogen werden, die die EU für ihre Strategie gewinnen will.
Der zentrale Mehrwert des Gutachtens besteht somit vor allem in der Verdeutlichung der Herausforderungen einer industriepolitischen Standortbestimmung in Zeiten disruptiver Veränderungen. Selbst die aus ökonomischer Sicht effizientesten politischen Mittel können die Risiken der grünen Transformation und der weltwirtschaftlichen Lage nicht ausschalten. Politik kann und sollte jedoch dazu beitragen, diese Risiken so zu verteilen, dass die Transformation als Industrieprojekt ökonomisch managebar und politisch durchsetzbar bleibt. Dafür braucht es auch zukünftig auf deutscher wie auf europäischer Ebene einen diversifizierten Politik-Mix, der von klaren Prinzipien geleitet, aber nicht gegängelt wird.
Zum Autor:
André Wolf ist Fachbereichsleiter für Technologische Innovation, Infrastruktur und industrielle Entwicklung am Centrum für Europäische Politik (cep) in Berlin.