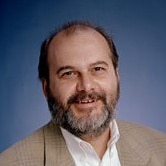Fast in der gesamten jüngeren Literatur, die den Brexit und den Erfolg Trumps analysiert, gibt es ein konstantes Thema. Es handelt vom Vergehen der berauschenden Tage am Ende des Kalten Krieges, es ist ein Schmachten nach einer Zeit, in der der unaufhaltsame Siegeszug von Demokratie und neoliberaler Wirtschaftspolitik eine Gewissheit war und der liberale Kapitalismus auf dem Gipfel menschlicher Errungenschaften stand.
Solche Narrative bereiten mir immer ein gewisses Unbehagen. Das ist teilweise darauf zurückzuführen, dass ich nie an sie geglaubt habe und meine persönliche Erfahrung eine andere war. Anstatt an das „Ende der Geschichte“ zu glauben, war das Ende des Kalten Krieges für mich ein ambivalentes Ereignis: für viele Menschen war es gut, weil es ihnen nationale Befreiung und das Versprechen auf höhere Lebensstandards gebracht hat – aber für andere war es traumatisch, weil es ihnen den Aufstieg von boshaftem Nationalismus, Kriege, Arbeitslosigkeit und desaströse Einkommensrückgänge brachte.
In dieser Wahrnehmung wurde ich dadurch beeinflusst, dass mir sehr deutlich bewusst war, dass der Bürgerkrieg in Jugoslawien unvermeidbar sein würde, als die Berliner Mauer fiel (ich erinnere mich noch genau an ein sehr düsteres Abendessen, dass ich mit meiner Mutter an jenem Tag im November hatte). Zudem erlebte ich aus erster Hand das plötzliche Elend, das Russland in den frühen 90er Jahren erlitt, als ich im Rahmen meiner Tätigkeit für die Weltbank dorthin reiste. Mir ist also klar, dass mein Unbehagen gegenüber dem Triumphalismus durch diese zwei, selten zusammenfallenden Umstände erklärt werden könnte. Es war also vielleicht ein sehr eigenwilliges Unbehagen.
Aber als ich andere Bücher las, und insbesondere den viel umjubelten Tony Judt, realisierte ich, dass dieses Unbehagen noch weiterging. In der Flut der Literatur, die nach dem Ende des Kalten Krieges geschrieben oder veröffentlicht wurde, fand ich so gut wie nichts, dass meine eigenen Erfahrungen des Jugoslawiens der 60er und 70er Jahre widerspiegelte. Egal wie sehr ich es auch versuchte – in meinen Erinnerungen fand ich nichts, dass auch nur ansatzweise mit Kollektivierung, Ermordungen, politischen Prozessen, endlosen Schlangen, eingesperrten Freigeistern und anderen Geschichten zu tun hatte, die in den Literaturzeitschriften veröffentlicht wurden. Das Ganze wird für mich noch merkwürdiger, weil ich politisch extrem frühreif war: Ich glaube, dass ich ohne Übertreibung politisierter war als 99% meiner Altersgefährten im damaligen Jugoslawien.
Aber meine Erinnerungen an die 60er und 70er Jahre sind anders. Ich erinnere mich an ausgedehnte Abendessen, bei denen wir über Politik, Frauen und Nationen diskutiert haben. An lange Sommerferien, Auslandsreisen, Sonnenuntergänge, Konzertnächte, epische Fußballspiele, Mädchen in Miniröcken, an den Geruch der neuen Wohnung, in die meine Familie zog, die Aufregung über neue Bücher und an den Kauf meiner Lieblingswochenzeitschrift am Abend bevor sie überhaupt in den Läden war … und ich finde nichts davon in den Schriften von Judt, Swetlana Alexijewitsch oder anderen Autoren.
Ich weiß, manche dieser Erinnerung könnten durch Nostalgie beeinflusst sein. Aber so sehr ich es auch versuche – sie sind immer noch die dominanten Erinnerungen. Und ich erinnere mich an so viele Details, dass ich nicht glaube, dass meine Nostalgie sie irgendwie „fabriziert“ hätte. Ich kann schlicht nicht sagen, dass sie nicht geschehen wären.
Daher ist mir klargeworden, dass ich mit all den anderen Erinnerungen an Osteuropa und den Kommunismus, die heute in der Literatur zu finden sind, praktisch nichts gemeinsam habe. Und ich habe 30 Jahre lang unter diesen Umständen gelebt! Ich weiß, dass meine Geschichte vielleicht nicht repräsentativ ist, nicht zuletzt deswegen, weil die 70er in Jugoslawien Jahre der Prosperität waren, und weil dieser periphere Teil Europas dank Titos „Bündnisfreiheit“ eine große weltpolitische Rolle spielte, die es 2.000 Jahre lang nicht hatte – aber selbst wenn ich meine Erinnerungen im Kontext dieser Umstände betrachte, glaube ich letztlich doch, dass auch andere, nicht-vorgegebene Geschichten der „Unterentwicklung“ und des Kommunismus das Recht haben, erzählt zu werden. Oder sollen wir mutwillig unsere Erinnerungen zerstören?
Allerdings ist es sehr schwer, diese anderen Geschichten zu erzählen. Man sagt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, und Storys, die nicht in diesen Narrativ passen, werden abgelehnt. Ich glaube inzwischen, dass dies besonders in den USA der Fall ist, wo während des Kalten Krieges eine formidable Maschinerie offener und versteckter Propaganda geschaffen wurde. Und diese Maschinerie lässt sich nicht so einfach abstellen. Sie kann keine Narrative produzieren, die nicht mit der dominanten Erzählung übereinstimmen, weil niemand diese glauben oder solche Bücher kaufen würde.
Fast täglich wird die Geschichte umgeschrieben, woran auch viele Menschen aus Osteuropa partizipieren: manche, weil sie glauben, solche Erinnerungen zu haben, manche, weil sie sich (oftmals erfolgreich) dazu zwingen zu glauben, dass sie solche Erinnerungen hätten. Andere bleiben bei ihren individuellen Erinnerungen, die mit ihrem Tod verloren sein werden. Der Sieg möge vollständig sein.
2006 war ich in Leipzig, um mir Spiel bei der Fußball-WM anzuschauen. Ich war sprachlos, als ich im Fenster eines kleinen Ladengeschäfts ein Foto der DDR-Mannschaft sah, die bei der WM 1974 mit 1:0 gegen die westdeutsche Mannschaft gewonnen hatte. Keiner der ostdeutschen Spieler wurde danach reich oder berühmt, sie waren alle nur irgendwelche Jungs von nebenan. Für mich war dieses Foto ein kleiner, rührender und in gewisser Weise sogar pathetischer Versuch, die Erinnerungen zu bewahren und zu sagen: „Wir haben in diesen 40 Jahren auch etwas getan; wir haben existiert; es war nicht alles bedeutungslos, böse und brutal.“
Wenn ich politisch an diese Jahre denke, gab es einen Moment, der für mich auf vielleicht seltsame Weise heraussticht. Es war der Sommer 1975, in Helsinki fand gerade die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa statt. Sie schloss ein Kapitel des Zweiten Weltkriegs und fand nur wenige Monate nach der Befreiung von Saigon statt. Und ich erinnere mich daran, wie ich am Strand saß, etwas über die Helsinki-Konferenz las, die beiden Ereignisse verknüpfte und dachte: in meinem Leben wird es in Europa keine Kriege mehr geben, und der Imperialismus ist besiegt worden. Wie falsch ich doch mit beidem lag.
Zum Autor:
Branko Milanovic ist Professor an der City University of New York und gilt als einer der weltweit renommiertesten Forscher auf dem Gebiet der Einkommensverteilung. Milanovic war lange Zeit leitender Ökonom in der Forschungsabteilung der Weltbank. Er ist Autor zahlreicher Bücher und von mehr als 40 Studien zum Thema Ungleichheit und Armut. Außerdem betreibt er den Blog Global Inequality, wo dieser Beitrag zuerst in englischer Sprache erschienen ist.