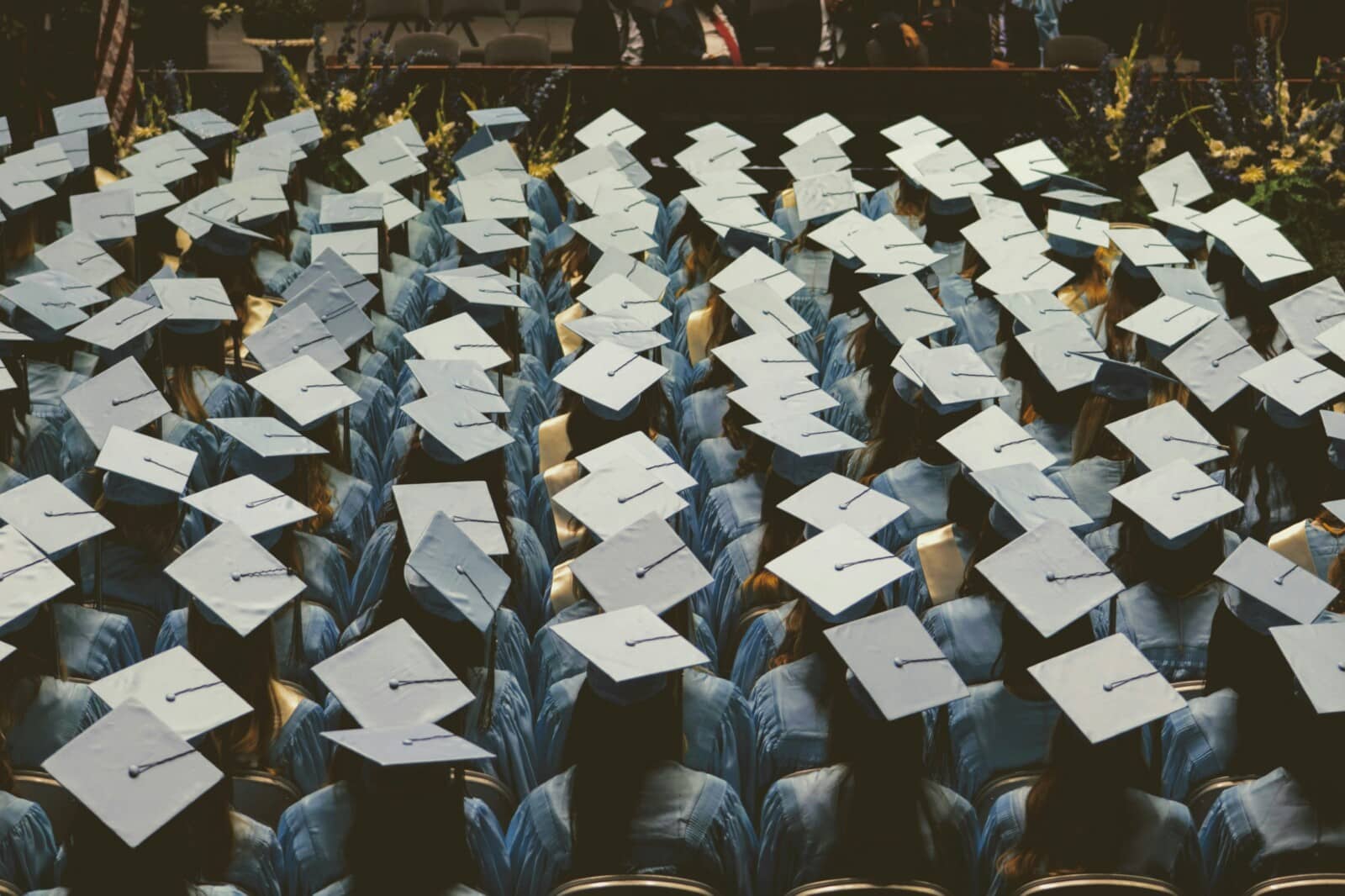In den 1930er und 1940er Jahren flohen eine halbe Million europäischer Wissenschaftler und Intellektueller vor dem Faschismus und fanden Zuflucht an Universitäten und in der Industrie der Vereinigten Staaten. Viele leisteten während und nach dem Zweiten Weltkrieg bahnbrechende Forschungsarbeit – nicht zuletzt Albert Einstein. Europa hat jetzt die Chance, sich zu revanchieren.
Viele exzellente Forscher sind durch den Angriff der Trump-Regierung auf die US-Wissenschaft bedroht. Jetzt ist der Moment für die Europäische Union gekommen, die besten Köpfe – egal ob Amerikaner oder Bürger anderer Länder – aufzunehmen, die die USA verlassen wollen. Die EU sollte Mittel bereitstellen, damit sie ihre Forschung fortsetzen können, und gleichzeitig die akademischen Arbeitsmärkte öffnen, auf denen es nicht genügend Wettbewerb gibt.
Es gibt gute Gründe dafür, dass die EU und nicht die Regierungen der Mitgliedsstaaten oder Universitäten diese Bemühungen koordinieren sollten. Erstens unterdrückt die US-Regierung die Forschung zu globalen öffentlichen Gütern, insbesondere die Klima- und Medizinforschung. Zum Wohle der gesamten Menschheit sollte Europa die Lücke schließen, damit die Forschung, die sich auf Datenbanken und Zeitreihen stützt, fortgesetzt werden kann.
Zweitens hat die EU ein aufgeklärtes Eigeninteresse daran, ihre eigene Forschung, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, mit Spitzenkräften der Weltklasse zu fördern. Seit Jahren beklagen die Europäer den Verlust innovativer Talente an die USA – nicht nur europäische Köpfe, sondern auch solche aus Indien, China und anderen Ländern. In Europa mögen die Gehälter niedriger und die Forschungseinrichtungen weniger üppig sein, aber der Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung und Bildung ist universell, und die Rechtsstaatlichkeit funktioniert noch. Vor allem für jüngere Forscher ist Europa attraktiver, um eine Familie zu gründen – und sie würden hier ihre besten Arbeitsjahre einbringen.
Drittens würden die europäischen Universitäten von einem Zustrom von Akademikern und Studenten von Weltrang profitieren, die ihre Forschung und Lehre verbessern und einige Einrichtungen, die selbstgefällig geworden sind, aufrütteln würden. Die EU ist unter den Spitzenuniversitäten unterrepräsentiert, aber auf den mittleren bis hohen Qualitätsstufen überrepräsentiert. Die europäischen Universitäten würden von der Einbeziehung von Akademikern und Forschern aus der Privatwirtschaft in vielen Disziplinen profitieren. Es bedarf eines Frameworks auf EU-Ebene, um einen völlig offenen Wettbewerb zu gewährleisten und nationale Bevorzugung zu verringern. Das Angebot sollte sich nicht nur an Naturwissenschaftler richten, sondern auch an Sozialwissenschaftler und andere, die von der US-Regierung mit Kürzungen und Verfolgung bedroht werden.
Frankreich und die Europäische Kommission haben bereits Initiativen angekündigt, um wissenschaftliche Talente anzuziehen. Diese Initiativen sind zu begrüßen, aber es fehlen Details, und die vorgesehenen Mittel erscheinen im Vergleich zur Bedeutung dieser Chance für Europa gering. Die von der Kommission vorgeschlagenen 500 Millionen Euro für drei Jahre wären nur ein winziger Bruchteil des gemeinsamen EU-Haushalts. Einige Institutionen in Ländern mit fiskalischem Spielraum, wie z. B. Deutschland und Frankreich, bemühen sich bereits um einen „Brain Gain”, indem sie nationale Mittel bereitstellen. Aber andere Länder werden Hilfe benötigen, um die Kosten zu stemmen.
Mehr Mittel auf EU-Ebene könnten z. B. durch den EU-Innovationsfonds zur Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich kohlenstoffarmer Technologien mobilisiert werden. Der Fonds verfügt über ein Jahresbudget von rund vier Milliarden Euro, von denen etwa 10% umgeschichtet werden könnten, um Spitzenforscher im Clean-Tech-Sektor zu gewinnen, die angesichts der weitgehenden Kürzungen der Trump-Regierung dringend mehr Unterstützung benötigen.
Auch die im Rahmen des NextGenerationEU-Programms (NGEU) bereitgestellten Mittel zur Unterstützung des grünen und digitalen Wandels werden nicht ausreichend genutzt. Über 350 Milliarden Euro (etwa die Hälfte der Gesamtmittel) wurden noch nicht ausgezahlt, weil die EU-Länder die Bedingungen des Programms nicht erfüllten – und NGEU läuft nur noch bis nächstes Jahr. Die EU-Länder haben grundsätzlich beschlossen, 55 Milliarden Euro der NGEU-Mittel für Forschung und Entwicklung zu verwenden. Angesichts der hohen Beträge, die noch nicht ausgegeben wurden, ist es an der Zeit, das Verfahren zu ändern und die nationalen Regierungen unter Druck zu setzen, auch im Hinblick darauf, für globale Talente attraktiver zu werden.
Im Rahmen der EU-Fazilität zur Bewältigung von Pandemien stehen über 40 Milliarden Euro an Zuschüssen zur Verfügung. Mit nur 5% dieses Betrags könnten über einen Zeitraum von fünf Jahren 400 Millionen Euro für die Förderung hochwertiger Forschung und Entwicklung bereitgestellt werden. Über einen Zeitraum von fünf Jahren könnte die EU allein aus der NGEU und der RRF rund vier Milliarden Euro mobilisieren. Dies würde es selbst den EU-Ländern mit den knappsten nationalen Budgets ermöglichen, bei der Anwerbung internationaler Spitzenforscher zu konkurrieren, z. B. für neue Forschungsprojekte zu digitalen Technologien und zum Klimawandel.
Die Marie-Curie-Stipendien der EU und die Stipendien des Europäischen Forschungsrats (ERC) sind bereits offen für Bewerbungen aus den USA und anderen Ländern. Es ist davon auszugehen, dass hochwertige Bewerbungen aus den USA zunehmen werden (wie dies bereits bei einem ähnlichen deutschen Programm der Fall war). Das kombinierte Marie-Curie-/ERC-Budget beläuft sich auf etwa vier Milliarden Euro, und eine Erhöhung um 20% wäre keine sonderliche Belastung.
Um Talente anzuziehen, sind unter anderem ein günstiges Forschungsumfeld, Zugang zu Finanzmitteln und wettbewerbsfähige finanzielle Bedingungen erforderlich. Die Zusammenarbeit mit industriellen Spitzenlaboratorien wäre ein Plus. Es sollte ein allgemeiner EU-Rahmen für die Verwendung dieser umgeschichteten Mittel geschaffen werden, um Voreingenommenheit auf nationaler Ebene zu vermeiden und einen offenen Wettbewerb zu gewährleisten, indem die Industrie zur Teilnahme an Projekten eingeladen wird.
Es wäre angemessen, wenn Europa die Modernisierung seiner Forschungsinfrastruktur durch die Anwerbung von Talenten aus dem Ausland finanzieren würde. Wir schlagen vor, diese Bemühungen als Projekt Einstein zu bezeichnen, zu Ehren des berühmtesten europäischen Wissenschaftlers, der vor fast einem Jahrhundert in den USA Zuflucht fand.
Zu den Autoren:
Heather Grabbe ist Gastprofessorin am University College London und der KU Leuven und Senior Fellow beim Thinktank Bruegel, wo dieser Beitrag zuerst auf Englisch erschienen ist.
Daniel Gros ist Direktor des Institute for European Policymaking an der Bocconi-Universität.