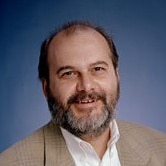Warum ist Ungleichheit wichtig? Diese Frage wird mir häufig gestellt, und wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder. Daher habe ich mich entschieden, meine Antwort aufzuschreiben.
Das Argument, warum Ungleichheit nicht wichtig ist, geht fast immer wie folgt: Wenn es jedem besser geht, warum sollte es uns kümmern, wenn jemand extrem reich wird? Vielleicht verdient er es ja, reich zu sein – und selbst wenn nicht, braucht uns das nicht zu kümmern. Und wenn es uns doch kümmert, dann stecken Neid und moralische Mankos dahinter. Ich bin auf das Neid-Argument schon verschiedentlich eingegangen (z. B. hier als Antwort auf Martin Feldstein und hier als Antwort auf Harry Frankfurt), und möchte dies nicht wiederholen. Lassen wir das Neid-Argument also bei Seite und konzentrieren uns auf die Gründe, warum uns eine hohe Ungleichheit Sorgen machen sollte.
Diese Gründe kann man in drei Gruppen herunterbrechen: instrumentelle Gründe, die mit Wirtschaftswachstum zu tun haben, Fairness-Gründe und politische Gründe.
Ungleichheit und Wachstum
Der Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Wachstum ist einer der ältesten, mit dem sich Ökonomen beschäftigen. Eine sehr starke Annahme lautete, dass es ohne hohe Profite kein Wachstum geben könne, und dass hohe Profite eben eine substantielle Ungleichheit implizieren. Dieses Argument finden wir schon bei Ricardo, wo der Profit der Motor des Wirtschaftswachstums ist. Wir finden es auch bei Keynes und Schumpeter, und dann in den Standard-Wachstumsmodellen. Wir finden es sogar in den sowjetischen Industrialisierungsdebatten. Um zu investieren, musst du Profite haben (also mehr als das, was du für den Lebensunterhalt benötigst).
In einer privatwirtschaftlichen Volkswirtschaft bedeutet dies, dass manche Menschen vermögend genug sein müssen, um zu sparen und zu investieren. Und in einer staatlich gelenkten Volkswirtschaft bedeutet es, dass der Staat den gesamten Überschuss einnehmen sollte.
Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass diese Argumentation überhaupt nicht für Ungleichheit per se plädiert. Wenn dem so wäre, würden wir uns über die Verwendung des Überschusses gar keine Sorgen machen. Das Argument dreht sich stattdessen um ein scheinbar paradoxes Verhalten der Reichen: Sie sollen ausreichend vermögend sein, aber sie sollen dieses Geld nicht verwenden, um gut zu leben und zu konsumieren – sondern um zu investieren. Keynes hat diesen Punkt bekanntermaßen im ersten Abschnitt seines Werks „The Economic Consequence of the Peace” sehr gut ausgeführt. Für uns reicht es an dieser Stelle aus zu erkennen, dass es sich um ein Argument zugunsten von Ungleichheit handelt – wohlgemerkt unter der Vorrausetzung, dass das Vermögen nicht zum privaten Vergnügen eingesetzt wird.
Die empirischen Arbeiten der letzten 20 Jahre haben es nicht geschafft, einen positiven Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Wachstum aufzuzeigen. Die Daten waren nicht gut genug, insbesondere wenn der Gini-Koeffizient verwendet wurde, der zu aggregiert und unbeweglich ist, um Veränderungen in der Verteilung zu erfassen. Zudem könnte der Zusammenhang aufgrund von anderen Variablen oder dem Entwicklungsstand variieren. Das hat Ökonomen in eine Sachgasse geführt und so sehr entmutigt, dass seit Ende der 90er und Anfang der 00er Jahre fast keine neue Literatur mehr dazu produziert wurde (mehr dazu im zweiten Kapitel dieses Papers).
Zuletzt hat jedoch das Argument, dass Ungleichheit und Wachstum negativ korreliert sind, an Boden gewonnen, auch deshalb, weil es inzwischen deutlich bessere Daten zur Einkommensverteilung gibt. In einem gemeinsamen Paper machen Roy van der Weide und ich genau diesen Punkt auf Basis von US-Mikrodaten für einen Zeitraum von 40 Jahren. Dank der besseren Daten und komplexerer Denkprozesse ist das Argument inzwischen nuancierter geworden: Ungleichheit dürfte gut für die zukünftigen Einkommen der Reichen sein (sie werden noch reicher). Aber sie dürfte schlecht für die zukünftigen Einkommen der Armen sein (sie fallen noch weiter zurück).
In diesem dynamischen Framework ist die Wachstumsrate nicht länger homogen, wie sie es ja auch im wahren Leben nicht ist. Wenn wir beispielsweise sagen, dass die US-Wirtschaft um 3% pro Jahr wächst, heißt das schlicht, dass die Einkommen insgesamt um diese Rate wachsen – aber es sagt uns überhaupt nichts darüber, wieviel besser oder schlechter es den Individuen an verschiedenen Punkten der Einkommensverteilung geht.
Warum sollte Ungleichheit aber einen negativen Effekt auf das Wachstum der unteren Dezile der Verteilung haben, wie Roy und ich zeigen? Weil sie sich auf negativ auf die Bildung (und sogar Gesundheit) der Armen auswirkt, die von sinnvollen Jobs ausgeschlossen werden, die sie leisten könnten, um sich selbst und die Gesellschaft voranzubringen. Es ist kann nie positiv für eine Volkswirtschaft sein, einer bestimmten Gruppe von Menschen den Zugang zu guter Bildung zu verweigern, sei es nun wegen ihres zu geringen Einkommens oder wegen ihres Geschlechts oder wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Oder zumindest kann ihre Exklusion nie besser sein als ihre Inklusion.
Eine Frage der Gerechtigkeit
Eine hohe Ungleichheit, die eine Gruppe von Menschen von einer vollständigen Partizipation ausschließt, übersetzt sich in Fairness- und Gerechtigkeitsfragen. Und zwar deshalb, weil sie die intergenerationelle Mobilität beeinträchtigt: Menschen, die relativ arm sind (und das ist es, was hohe Ungleichheit meint), können ihren Kindern nicht einmal einen Bruchteil der Vorzüge bieten, die die Reichen ihren Nachkommen geben, von Bildung über Erbschaften bis hin zu sozialem Kapital, und zwar selbst dann nicht, wenn sie in einem absoluten Sinne gar nicht arm sind. Dies impliziert, dass Ungleichheit dazu neigt, über Generationen hinweg anzuhalten, was wiederum bedeutet, dass sich die Chancen an der Spitze der Pyramide erheblich von denen in den unteren Etagen unterscheiden.
Wir können also zwei zusammenwirkende Kräfte beobachten: einerseits den negativen Effekt von Exklusion auf das Wachstum, der über sich über Generationen hinweg fortsetzt – das ist unser instrumenteller Grund, hohe Ungleichheit nicht zu mögen. Andererseits gibt es noch einen Mangel an Chancengleichheit – was ein Gerechtigkeitsproblem darstellt.
Hohe Ungleichheit hat auch politische Effekte. Die Reichen besitzen mehr politische Macht, die sie nutzen, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben und ihre relative gesellschaftliche Position zu etablieren. Das heißt nichts anderes, als dass die negativen Effekte der Exklusion und des Mangels an Chancengerechtigkeit verstärkt und permanent gemacht werden, zumindest solange, bis ein großes soziales Erdbeben sie zerstört.
Um die Entstehung eines solchen Erdbebens abzuwenden, müssen die Reichen sich absichern und unangreifbar machen. Dies führt wiederum zu einer konfliktären Politik und zerstört die soziale Kohäsion. Ironischerweise hält die daraus resultierende soziale Instabilität die Reichen davon ab zu investieren – was bedeutet, dass genau jene Handlung unterminiert wird, die anfangs als Hauptgrund angeführt wurde, warum hohes Vermögen und Ungleichheit sozial erstrebenswert sein sollten.
Somit erreichen wir also den Endpunkt, an dem eine Aneinanderreihung von Aktionen, die ursprünglich das Ziel hatten, vorteilhafte Ergebnisse zu produzieren, mit ihrer eigenen Logik den ursprünglichen Grundgedanken zerstören. Wir müssen also an den Ausgangspunkt zurückkehren. Dann werden wir erkennen, dass eine hohe Ungleichheit nicht Investitionen und Wachstum fördert, sondern im Laufe der Zeit das genaue Gegenteil hervorbringt: weniger Investitionen und weniger Wachstum.
Zum Autor:
Branko Milanovic ist Professor an der City University of New York und gilt als einer der weltweit renommiertesten Forscher auf dem Gebiet der Einkommensverteilung. Milanovic war lange Zeit leitender Ökonom in der Forschungsabteilung der Weltbank. Er ist Autor zahlreicher Bücher und von mehr als 40 Studien zum Thema Ungleichheit und Armut. Außerdem betreibt er den Blog Global Inequality, wo dieser Beitrag zuerst in englischer Sprache erschienen ist.